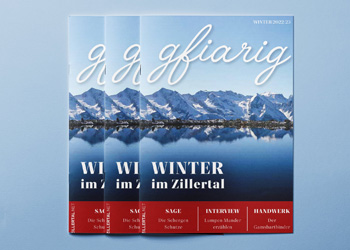Ausflugsziele
Wallfahrtskirche Maria Brettfall Strass
Hoch droben, am Eingang des Zillertals:
Hoch über Strass, auf einem 700 Meter hoch gelegenen Felskopf, ragt sie empor – die Wallfahrtskirche und einstige Einsiedelei Maria Brettfall, eine Station des Tiroler Jakobsweges. Erwandert werden kann sie von Strass aus entlang der Kreuzwegstationen in rund 30 Minuten, von Rotholz aus in rund 45 Minuten.
Einst soll sich auf dem Felsen eine Wallburg befunden haben. Im Schwazer Bergbuch findet die "Erbauung von Kirchlein und Eremitage Maria am Brettfall" erstmals 1536 Erwähnung. Der Name "Maria Brettfall" kommt aus dem Lateinischen und leitet sich entweder vom Ausdruck "super vallem" – "über dem Tal" oder "prae vallum" – "vor dem Wall" ab. Eine andere Möglichkeit besagt, dass der Name sich auf den devonischen Schwazer Dolomit, aus dem der Felsen besteht, bezieht. Durch den Berg führt der 1336 m lange Brettfalltunnel der Zillertalstraße.
Um das Jahr 1650 herum sind die ersten Blinden und Kranken zu "Maria Brettfall" gepilgert, um Genesung zu finden. 1671 ist schließlich eine Bretterkapelle und 1711 die erste gemauerte Kirche entstanden. Die kleine Kirche, die aus einem quadratisch angelegten Kirchenschiff sowie aus einem achteckigen Turm inklusive Kuppel und Laterne besteht, steht heute noch an ihrem Platz und in ihr seit 1765 eine Gnadenstatue über dem Tabernakel. 
1729 ist sie geweiht, von 1851 bis 1853 restauriert worden. Zudem sind Seitenaltäre geschaffen worden – links sind der Heilige Antonius und der Heilige Leonhard zu sehen, auf der rechten Seite der Heilige Wendelin und der Heilige Aloisius. Über dem Eingang ziert das 1947 von Rafael Thaler geschaffene Marienfresko mit Sonnenuhr die Kirche. 2006 und 2007 ist die Kirche abermals renoviert, ein Jahr später sind die Kreuzwegstationen erneuert worden. Die ganzjährig in der Kirche aufgestellte Krippe stammt aus dem 19. Jahrhundert.
Die einstige Einsiedler-Wohnung oberhalb der Kirche ist in den Jahren 1961 bis 1980 zu einem Gasthaus umgebaut worden. Der erste Einsiedler auf Maria Brettfall ist 1536 Stoff Weymoser gewesen, einer der bekanntesten Franz Margreiter aus Alpbach. Diesem ist es zu verdanken, dass nach den Schließungen durch Kaiser Josef II im Jahr 1786 sowie durch bayerische Behörden im Jahr 1810 Maria Brettfall nach jeweils einem Jahr wieder geöffnet werden hat können. Betätigt hat sich "Brettfallfranzl" als Kupferstecher und so etliche Andachtsgegenstände geschaffen, bis er 1829 bei einem Brand in der Einsiedelei ums Leben gekommen ist. 1843 ist Einsiedler Nikolaus Anhell von der Kuratie abgelöst worden und hat fortan als Mesner gewirkt. Die Klause gehört bis heute zur Kuratie, der letzte Mesner, Josef Schmiderer, ist 1944 verstorben.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Brettfall
Schwimmvergnügen, Bergsee-Surfen und mehr
Der Durlaßboden-Stausee
als Paradies für Wassersportler
Er gilt als Sommerhighlight in der Region Zillertal Arena – der Durlaßboden-Stausee in Gerlos. Sein quellfrisches Gebirgswasser erwärmt sich in den Sommermonaten bis auf 21 °C und lädt zum Plantschen, Schwimmen, Tauchen und Tretbootfahren ein.

Am Durlaßboden-Stausee, direkt an der Stausee-Dammkrone, befindet sich auf 1400 Meter Seehöhe Österreichs höchstgelegene Surfschule mit Bootssteg direkt an der Stausee-Dammkrone, ebenso wartet ein Treetboot-Verleih auf. Taucher haben im Herbst die größten Sichtweiten, diese reichen dann nämlich bis zu 20 Meter. Auf der großen Liegewiese am See ist Platz zum Entspannen, der Eltern-Kind-Bereich punktet mit attraktivem Spielplatz, Grillfreunde haben die Möglichkeit, ihren kulinarischen Freuden zu frönen. 
Die Rundwanderung um den Gerlos-Stausee bietet Einkehrmöglichkeiten auf der Bärschlagalm, im Gasthof Finkau sowie im Seestüberl auf der Dammkrone. Zudem kann der Erlebnisweg bestens mit weiterführenden Wanderungen kombiniert werden. Tempo ist beim Gerloser Seelauf angebracht. 
Der 12,6 Kilometer lange Cross-Country-Lauf, der jährlich Mitte August stattfindet, führt entlang des Stausees in Richtung Bärschlagalm.
Zillertaler Heumilch-Sennerei
Milchverarbeitung nach alter Tradition
Über 270 Landwirte liefern täglich frische Heumilch an die Zillertaler Heumilch-Sennerei in Fügen, die als Genossenschaft im Eigentum der Bauern steht. Höchste Produktqualität, verbunden mit dem Wohlergehen der Heimat, dem Zillertal, ist das oberste Bestreben. Deshalb wird im Betrieb ausschließlich reinste, gentechnikfreie Heumilch verarbeitet.
Die Heumilch-Herstellung gilt als ursprünglichste Form der Milchgewinnung, angepasst an den Lauf der Jahreszeiten. Im Sommer finden Heumilchkühe neben klarem Wasser eine Vielfalt an saftigen Gräsern und Kräutern auf den heimischen Wiesen, Almen und Weiden. Der Pflanzenreichtum ist ausschlaggebend für die hochwertige Qualität und den Geschmack von Heumilch. Denn je höher der Artenreichtum, desto höher Qualität und Aroma der Rohmilch.
Im Winter werden die Tiere mit sonnengetrocknetem Heu und mineralstoffreichem und selbstverständlich gentechnikfreiem Getreideschrot versorgt. Tabu sind vergorene Futtermittel wie Silage.
Die Heumilchbauern haben sich einer besonders schonenden und extensiven Wirtschaftsweise verschrieben, die sich positiv dem Wohle der Tiere sowie auf die Natur auswirkt und zudem zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. Neben artgerechter Fütterung bekommen die Tiere ausreichend Bewegung, gemütliche Ruheplätze und werden von den Heumilchbauern persönlich betreut.
Eine dauernde Anbindehaltung ist verboten, die Heumilchkühe sind im Laufstall untergebracht oder bekommen übers Jahr mindestens 120 Tage Auslauf. Für ein angemessenes Stallklima mit viel Frischluft und ausreichend Platz, auch zum Liegen, da Kühe den halben Tag mit Ruhen verbringen, wird gesorgt. Ob auf der Weide oder im Stall – den Tieren steht stets genügend frisches Wasser zur Verfügung, brauchen sie doch zum Wohlfühlen an die 120 Liter pro Tag.
Gesunde Tiere, hochwertige Produkte
Naturnahe Haltung und Fütterung der Heumilchkühe schlagen sich ebenfalls im Geschmack der Milch und Milchprodukte nieder. Durch den Verzicht auf vergorene Futtermittel kann Käste ohne intensiv-mechanische Behandlung und Zusatz von Konservierungsmitteln hergestellt werden. Besonders für Käse, der länger reifen muss, ist hochwertiger Rohstoff unerlässlich.
Die Gesundheit ihrer Heumilchkühe ist den Heumilchbauern oberstes Gebot, eine Mitgliedschaft beim Tiergesundheitsdienst ist deshalb eine Selbstverständlichkeit. Durch regelmäßige Kontrollen mit professioneller Beratung durch den Tierarzt wird vorbeugend das Wohlergehen der Tiere überprüft.
So naturnah und traditionell wie Heumilch wird sonst keine Milch hergestellt. Die Milch für die Zillertaler Heumilch-Sennerei wird ausschließlich von Bauern aus der Region geliefert. In der Produktion sorgen acht Mitarbeiter für die Veredelung der Milch und zwar nach alter Tradition. Der "Weg der Milch" wird von verschiedenen Qualitätskontrollen begleitet. Weit über die rechtlichen Bestimmungen – darunter das strenge österreichische Lebensmittelrecht (LMR), die AMA-Gütesiegel-Richtlinien, die EU-Hygiene-Verordnung sowie Bio-Kontrollen – werden in der Zillertaler Heumilch-Sennerei auf freiwilliger Basis Prüfungen nach dem HACCP-Konzept sowie dem FSCC22000 durchgeführt.
Schaukäserei und Museum
Einen informativen Einblick in die Arbeitswelt einer Sennerei gibt der Besuch der Schaukäserei, wo beobachtet werden kann, wie der Käsemeister frische Heumilch zu Qualitätsprodukten verarbeitet. Im Käserei-Museum wird die Geschichte der Sennerei gezeigt und zudem ein Eindruck in die Käseproduktion vor 100 Jahren vermittelt.
Bei den ca. 30-minutigen Führungen (Montag bis Freitag) verdeutlicht am Beginn der Besichtigung ein Film die Veredelung des Rohstoffs Milch. Anschließend folgen eine Filmpräsentation der Schaukäserei, Museumsbesichtigung sowie Gratis-Käseverkostung. 
Führungen für Gruppen (ab zehn Personen) werden jederzeit nach vorheriger Anmeldung angeboten.
Kontakt:
ZILLERTALER HEUMILCH SENNEREI
SENNEREISTRASSE 2
6263 FÜGEN
TEL.: 05288/62334
FAX: 05288/62334-4
HolzErlebnisWelt bei binderholz im Zillertal
Holz mit allen Sinnen genießen
Das FeuerWerk ist die HolzErlebnisWelt bei binderholz in Fügen. Vier Bereiche stehen den Besuchern zur Verfügung.
Wer sich für eines der modernsten und wirtschaftlichsten BioMasseHeizKraftWerke Europas interessiert, der erhält bei der Führung durch dieses auf zehn Stationen mittels Audio-Guide technische Einblicke und erfährt zudem Wissenswertes zu den Themen Ökostrom- und Pelletsproduktion, Fernwärme, Geschichte des Holzes sowie Klimaveränderung.
Der 13-minütige Film „HolzWerk“ zeigt den Weg des Holzstammes von der Ernte im Wald durch die diversen Produktionen in den binderholz-Standorten bis zu seiner neuen Bestimmung als wertvolles Massivholz.
Umgeben von qualitativ hochwertigen Naturmaterialien sind Teilnehmer ebenfalls in den 16 Meter hoch liegenden Tagungsräumen, die mit Massivholzprodukten aus hauseigener Produktion ausgestattet sind. Ein ideales 
Ambiente für Tagungen, Seminare, Betriebsfeiern, Hochzeiten und sonstige Familienfeste.
Das Kraftwerk als Kulturraum – das Kulturgeschehen im FeuerWerk ist geprägt von Konzerten, Lesungen und weiteren Veranstaltungen. In der Galerie finden laufend Ausstellungen namhafter nationaler wie internationaler Künstler statt. So erhält „Holz als Werkstoff der Kunst“ einen besonderen Stellenwert.
Gastronomie im FeuerWerk ist in der SichtBAR angesagt, die durch ansprechende Architektur und mit einer beeindruckenden Aussicht auf die Zillertaler Bergwelt besticht. Ein Ort zum Verweilen ist ebenfalls der „Garten der Lüfte“. Hier kann von der Sonnenterrasse und vom Dachgarten aus das geschäftige Treiben auf dem binderholz-Werksgelände von oben verfolgt werden.
Einen umfassenden Eindruck aller Angebote vermittelt das Video „FeuerWerk“.
Erholung & Action am Schlitterer See

Als familienfreundlicher, am Zillertaler Radwanderweg gelegener Badesee wartet der Schlitterer See mit allerlei Attraktionen auf.
Wohlfühlen ist angesagt am Schlitterer Badesee, und das für Groß und Klein. Gleich bei der Ankunft beginnt das Entspannen, denn Gratis-Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Im Areal führt ein Schwimmsteg zum Badevergnügen, eine großzügige Liegewiese lädt zum Relaxen ein. Die Jüngsten sind im Kleinkinderbereich beim Baden und Spielen bestens aufgehoben. Weiters locken ein überdachter Sandspielplatz, Baumhäuser, Rutschen, Riesenschaukeln, Sandkisten, Klettersteige, Brunnen, Hängematten und vieles mehr große und kleine Kids zum Austoben. Sportliche kommen am Beachvolleyball-Platz auf ihre Kosten.
Erholen und kulinarisch genießen – im Café & Restaurant Schlitterer See ist der ideale Platz dazu. Denn wo könnte gemütliches Verweilen schöner sein als direkt am Badesee, ob auf der großzügigen Sonnenterrasse oder im modern eingerichteten Lokal.
Badebetrieb am Schlitterer See ist von Mai bis September, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, Gertrud Hellweger und Josef Keiler freuen sich auf die Badegäste.
Kindern bis acht Jahre ist der Zugang zum Badesee nur unter Aufsicht einer volljährigen Begleitperson gestattet, Hunde sind nicht erlaubt. Kinder bis sechs Jahre sind frei, für Saisonkarten ist ein Foto mitzubringen. Die Badeordnung ist einzuhalten.
Fisch- & Angelteich „Bochra See“
Angeln - Relaxen - Genießen
„Mach‘ doch mal Pause und gönn‘ dir etwas Ruhe“, heißt es im Flyer zum „Bochra See“. Und einfach einmal auszuspannen, dazu lädt allein schon die schöne Lage des Fisch- & Angelteichs in Stumm, direkt am Zillertal Radweig, ein.

Hier ist es gut, die Seele baumeln zu lassen und so ganz nebenbei noch den ein oder anderen großen oder kleinen Fisch zu angeln. Im rund ein Hektar großen See tummeln sich 350 bis 1500 Gramm schwere Regenbogenforellen, Lachsforellen, Karpfen und Saiblinge. Und Fisch ist gesund, enthält er doch wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die Vitamine B12 und D sowie den Eiweißbaustein Tryptophan. Kein Wunder, werden in Österreich pro Jahr und Kopf 7,5 Kilo Fisch und Meeresfrüchte verzehrt. Qualität ist bei Fisch aus dem „Bochra See“ gewährleistet. Die Betreiber Familie Andreas und Martina Rißbacher achten auf gute Wasserqualität, bestes Futter, geringe Besatzdichten sowie Besatzfische aus kontrollierten Betrieben. „In der heutigen Zeit ist uns vom ‚Bochra See‘ ein respektvoller und achtsamer Umgang mit Tier und Natur besonders wichtig!“
Ob Profi oder Anfänger – am „Bochra See“ ist jeder willkommen, ein Angelschein ist zum Fischen nicht nötig, einige Regeln gilt es zu beachten. Fliegenfischern stehen am nördlichen Ufer zwei separate Bereiche zur Verfügung. Leihgeräte wie Angeln, Kübeln, Kescher, Zangen etc. können ausgeliehen, Köder gekauft werden. An der kleinen Verpflegungsstation „Tina‘s Cafe am See“ wird nicht nur Anglern, sondern gleichfalls Spaziergängern und Radfahrern ein Ort zum gemütlichen Beieinandersitzen und kulinarischen Genießen angeboten. Kinder können einstweilen am Spielplatz ihrem Bewegungsdrang nachkommen.
Geöffnet ist der „Bochra See“ im Sommer Dienstag bis Sonntag von 7.30 bis 19.00 Uhr, Montag ist Ruhetag.
Heimatmuseum in der Widumspfiste in Fügen
In dem vom Heimat- und Museumsverein geführten Museum in der Widumspfiste wird als Schwerpunkt die Geschichte der Zillertaler Sängerfamilien und die damit verbundene Verbreitung des Liedes "Stille Nacht" in die ganze Welt dokumentiert. 
Als Mehrspartenmuseum werden aber auch Kunstgegenstände, Krippen, Handwerkskunst, , die Wiederentdeckung der Rinderrasse Tux-Zillertal, die Holzbearbeitung und das rege Vereinsleben auf ungefähr 1000 m2 präsentiert. 
Einen großen Bereich nimmt auch der Bergbau im vorderen Zillertal ein. Für seine vorbildliche Führung erhielt das Museum auch das Museumsgütesiegel Österreichs.
Eine gute Informationsquelle ist die Webseite des Heimatmuseums – 
www.hmv-fuegen.at
Das Museum ist von DI bis FR jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Führungen können jederzeit nach Voranmeldung durchgeführt werden.
Karl von Edel Hütte – 2238m
Ende 1887 beschloss die Sektion Würzburg, zur touristischen Erschließung der Ahornspitze im Fellenbergkar eine Schutzhütte zu errichten. Sie sollte nach Carl von Edel, dem liberalen Politiker und Gründungsvorsitzenden der Sektion Würzburg, benannt werden. 1888 konnte mit der aus Stein zu bauenden Hütte begonnen werden. Sie war innen vertäfelt und bestand aus Bergführerzimmer, Speisezimmer und Küche im Erdgeschoß, sowie einer Schlafkammer für die Hüttenwirtin und Übernachtungsmöglichkeiten für 14 Herren und 7 Damen im Obergeschoß. Die Eröffnung der Hütte erfolgte 1889. Sie war zunächst nur im Sommer bewirtschaftet.
Durch den Bau der Zillertalbahn bis Mayrhofen im Jahr 1902 wurden Ahornspitze und Edelhütte als Bergziele noch attraktiver. Bereits 1905 wurde deshalb die Hütte deutlich erweitert und bot nun 24 Betten in zwölf Zimmern sowie ein Matratzenlager mit sieben Plätzen an. Im Lawinenwinter 1950/51 wurde der Anbau der Edelhütte von 1905 komplett zerstört und der Altbau so verschoben, dass eine Nutzung nicht mehr möglich war. Erst in der Sommersaison 1958 war die Edelhütte so weit hergestellt, dass wieder eine Bewirtschaftung angeboten werden konnte. Der Bau der Ahornbahn 1969 verkürzte den langen Anstieg zur Hütte und eröffnete der Edelhütte einen wesentlich größeren Besucherkreis. 1975 wurde die Edelhütte erneut durch eine Lawine zerstört. 
Drei Jahre später erfolgte der Wiederaufbau, bei dem die Edelhütte ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt.
Dominikushütte – 1805m
Die im Zamsergrund liegende Schutzhütte wurde 1883 von der Sektion Prag des DÖAV erbaut. 
Namensgeber war das Sektionsmitglied Hermann Dominikus, der von Beruf Buchhändler war und den Bau seiner Sektion zum Geschenk machte. Nach dem Tod des Stifters kaufte die Familie Eder vom Wirtshaus Breitlahner die Hütte, ehe sie 1890 der bekannte Zillertaler Bergführer Hans Hörhager erwarb und bis zum Kriegsende 1918 betrieb. Im gleichen Jahr brannte die Hütte aus ungeklärten Gründen bis auf die Grundmauern nieder. Bald darauf baute Hörhager die Hütte wieder auf, die dann von seiner Tochter Lisl geführt wurde. 
Bis zum Ende des ersten Weltkrieges verlief ungefähr ½ Stunde Gehzeit oberhalb des Gasthauses Breitlahner die Grenze zwischen den Bezirken Sterzing und Schwaz. Nach dem Ende des ersten Weltkrieges wurde diese Bezirksgrenze gleichzeitig vorläufige Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien. Die Dominikushütte stand somit plötzlich in Italien und die Inhaberfamilie benötigte einen Reisepass um auf die Hütte zu gelangen. Durch die endgültige Grenzziehung (1947) gelangte die Dominikushütte wieder auf Österreichisches Gebiet. Ende der 1960er Jahre begann die Tauernkraftwerke AG mit dem Bau des Schlegeisspeichers. Die alte Hütte musste aufgegeben werden, da sie im Stausee versunken wäre. Der Abriss erfolgte 1966. Als Ersatz bauten die Tauernkraftwerkein der Nähe der Staumauerkrone ein wesentlich größeres Bauwerk in zweigeschoßiger Bauweise. 
Der Name Dominikushütte wurde beibehalten, obwohl das neue Haus eher die Bezeichnung Gasthof verdient.
Spannagelhaus – 2531m
Das Spannagelhaus liegt mitten im Hintertuxer Gletscherschigebiet am Fuß des Olperers.
Im Jahre 1885 wurde die Hütte eröffnet und nach Franz Xaver Wery benannt, der diese Hütte aus eigenen Mitteln finanzierte. Bereits 1908 wurde der Neubau der Hütte eingeweiht und auf den Namen Spannagelhaus umbenannt. Rudolf Spannagel war Präsident des Österreichischen Touristenklub und beim Klettern auf der Raxalpe tödlich verunglückt.

Die Hütte war viele Jahre lang ganzjährig bewirtschaftet, 1978 erfolgte ein Zubau und war im Eigentum des Österreichischen Touristenklub. 2013 wurde sie an die Zillertaler Gletscherbahn verkauft, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Durch die besondere Lage mitten im Schigebiet hat die Hütte ihren Status als alpine Schutzhütte verloren.

Spannagelhöhle
Direkt neben dem Spannagelhaus befindet sich die Spannagelhöhle, die höchstgelegene Großhöhle Europas. Im Jahre 1919 entdeckte Alois Hotter, der damalige Hüttenwirt des Schutzhauses den Höhleneingang. Er bezeichnete die Höhle als “Grausliches Loch” und benutzte sie in der Folge, wie auch mehrere Pächter nach ihm, als Abfallgrube. 1960 wurde die Höhle erstmals erkundet und 1964 zu einem Naturdenkmal erklärt. Ab 1968 wurde diese Höhle intensiv erforscht. Zur Zeit sind etwa 12,5km erkundet und im Rahmen einer Führung können 500m besichtigt werden. Besonders interessant sind die Sinterbildungen, Tropfsteine und Bändermarmore.
Tuxerjochhaus – 2313m
Diese Schutzhütte ist nicht ganzjährig bewirtschaftet und liegt am Übergang vom Zillertal ins Schmirntal im hintersten Tuxertal.
Das Tuxerjochhaus wurde 1912 vom Österreichischen Touristenklub erbaut.
Bereits in prähistorischer Zeit führte ein Saumweg über das Tuxer Joch, das beweisen Gerätefunde von südalpinem Feuerstein. Ebenso wurde im Jochbereich eine Schmucknadel aus Bronze gefunden, die der Bronzezeit zugeordnet wird. Da früher die Ortschaft Tux kirchlich zu Schmirn gehörte, mussten auch die Toten über das Joch zum Friedhof Mauern bei Steinach gebracht werden. Die kirchliche Teilung wurde geändert, aber die weltliche Verwaltungsgrenzänderung erfolgte erst 1926.

Heute wird dieser Übergang vom Zillertal ins Wipptal gerne von Wanderern benützt.
Rifflerhütte (verfallen) – 2234m
Die ehemalige Rifflerhütte wurde nach Entwürfen des Johann Stüdl (ein Prager Kaufmann und Förderer des Alpinismus in Österreich) oberhalb der Birglbergalm und ca. 70 HM unterhalb des Rifflersees im Jahre 1887 erbaut und 1888 eröffnet. Sie war eine Selbstversorgerhütte und bot etwa 20 Personen Platz.

Im Frühjahr 1896 wurde sie durch eine Lawine stark beschädigt. 1900 erwarb die Sektion Berlin die Hütte und setzte sie instand.

Im März 1945 soll die Hütte durch eine Staublawine zerstört worden sein.
Sie wurde nicht mehr aufgebaut.
Die Rastkogelhütte – 2124m
Die Rastkogelhütte liegt knapp unterhalb des Sidanjoches im Almgebiet des Schwendberges.

Wie erreicht man die Rastkogelhütte
Die Rastkogelhütte hat einen nur sehr kurzen Anstiegsweg. Dieser beginnt in der Sidanalm am Hochschwendberg. Von einem kleinen Parkplatz an der Zillertaler Höhenstraße aus (1. Kehre nach der Mautstelle) erreicht man die Hütte in etwa 45 min.
Geschichte Rastkogelhütte
Sie wurde 1930 von der Sektion Werdau und Sachsen-Altenburg gebaut. Die Hütte entsprach dem damaligen hohen Standard, was Größe und Ausstattung betraf. Auf der Grundfläche von 10 x 14m wurde ein aus Bruchsteinblöcken der nahe gelegenen Sidanalm das Erdgeschoß errichtet, darüber der 1. Stock mit 12 Betten und 18 Matratzenlagern und das Dachgeschoß mit 20 Heulagern als Blockbau in Holz. Elektrizität für Küche, Heizung und Beleuchtung erleichterten den Hüttenalltag ungemein, für einen bequemen Aufenthalt sorgten zu dem fließendes Warm- und Kaltwasser in den Zimmern. Inmitten unsicherer Besitzverhältnisse vernichtete ein Großbrand im November 1953 die Rastkogelhütte.

Trotz widriger Rahmenbedingungen begann man mit dem Wiederaufbau und konnten 1955 die Hütte wieder eröffnen. In den folgenden Jahrzehnten folgten Sanierungsmaßnahmen, großteils die Wasserversorgung betreffend.
Wie die meisten Hütten, die von ostdeutschenSektionen erbaut wurden, blickt die Rastkogelhütte auf eine wechselvolle Besitzergeschichte zurück. Erbaut von den beiden Sektionen Werdau und Sachsen-Altenburg, musste 1938 die Sektion Sachsen-Altenburg aufgrund der drückenden Schuldenlast vom Hüttenvertrag zurücktreten, und die Sektion Werdau wurde zum alleinigen Hüttenbesitzer.
Nach der verordneten Auflösung der Sektion Werdau nachdem 2. Weltkrieg wurde diese nicht wieder mit Sitz im Westen Deutschlands gegründet. Dafür übernahm 1956 die in Oberkochen gegründete Sektion Jena die Treuhandschaft über die Rastkogelhütte. Durch die Umbenennung der Sektion Jena in die Sektion Oberkochen im Jahre 1972 wurde der Weg geebnet, damit 1976 die Rastkogelhütte per Kaufvertrag in den Besitz der Sektion Oberkochen übergehen konnte. Um die Verwirrung perfekt zu machen: Die Sektion Jena wurde nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 in Jena wieder gegründet, die Rastkogelhütte verblieb aber bei der Sektion Oberkochen.
Das Friesenberghaus – 2498m
Das Friesenberghaus liegt am Fuß des Hohen Rifflers hoch über dem Zamser Grund auf etwa 2500m Höhe. Einerseits bietet sich von dort aus ein herrlicher Tiefblick zum Schlegeisspeicher und andererseits liegt auch ein natürlicher Hochgebirgssee, der Friesenbergsee, in unmittelbarer Hüttennähe. 
Wie erreicht man das Friesenberghaus
Vom Parkplatz Schlegeis, nahe der Dominikushütte, der über eine Mautstraße von Ginzling aus erreichbar ist, geht es zuerst durch einen wunderschönen Zirbenwald über die Friesenbergalmin ca. 3 Stunden zum Friesenberghaus.
Geschichte: Friesenberghaus
Die Geschichte des Friesenberghauses beginnt im Vergleich zu den anderen Alpenvershütten im Zillertal relative spät – erst in den letzten 1920er Jahren.
600 großteils aus den jüdischen von DAV und ÖAV ausgeschlossene Mitglieder gründeten 1924 einen neuen Verein, den “Deutschen Alpenverein Berlin” der zusammen mit dem Verein “Donauland” das Friesenberghaus plante und in den Jahren 1928 – 1930 die Hütte erbaute. Den Baugrund stellte der Alpenverein Donauland zur Verfügung. Diese beiden Vereine errichteten eine für die damalige Zeit herausragende Hütte mit massiven Natursteinmauern. Im Erdgeschoß befanden sich Speiseraum, Tagesraum, Küche und Zimmer für die Bewirtschafter. Ein-, Zwei- und Vierbettzimmer im Obergeschoß und Schlafräume und Lager im Dachgeschoß. In den meisten Schlafräumen befanden sich Waschbecken mit fließendem Wasser. 1931 wurde die Hütte erstmals bewirtschaftet und 1932 feierlich eröffnet.
1934 wurde der Berliner Verein von den Nationalsozialisten verboten, 1938 nach dem Anschluss Österreichs auch Donauland. Das Friesenberghaus wurde danach von der Wehrmacht beschlagnahmt und nach dem Krieg völlig geplündert. Mit Unterbrechung der Kriegsjahre blieb die Schutzhütte bis 1968 in deren Besitz, dann überließ der Alpenverein Donauland die Hütte der Sektion Berlin des DAV.
Nach mehrjährigen Instandsetzungsarbeiten folgte eine Wiederinbetriebnahme 1964. Umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten brachten das Schutzhaus 2003 auf den neuesten Stand der Technik und zu einer internationalen Begegnungsstätte gegen Intoleranz und Hass. Heute erinnern im Friesenberghaus noch 12 Stühle an die Widerstandssektionen von 1924.
Die Gamshütte – 1921m
Die Gamshütte liegt - gut sichtbar von Mayrhofen aus - am Fuß der Grinbergspitzen zwischen Tuxertal und Zemmgrund.
Die Schutzhütte wurde 1927 von Alois Wegscheider aus Mayrhofen erbaut, mit den Maßen 8,4 x 8,1m und war dem Aussehen nach ganz ähnlich den benachbarten Hütten. Sie beherbergte im Erdgeschoß Gästezimmer, Küche, Speisekammer und Zimmer für die Bewirtschafter und im Dachgeschoß waren 18 Lager untergebracht. Im Laufe der Jahre veränderte sich das Aussehen der Hütte nur wenig.

Die Gamshütte wurde 1932 an die Sektion Kurmark verkauft. Da nach dem Zweiten Weltkrieg die Sektion Kurmark aufgelöst wurde, ging die Hütte 1949 in den Besitz der Sektion Berlin über.

Der letzte Besitzerwechsel erfolgte 1993, als die Sektion Offerting die Gamshütte erwarb. Ein Anbau mit Erweiterung des Gastraumes und mit zusätzlichen Kellerräumen wurde erstellt und 1997 ersetzte man das Holzschindeldach im Zuge einer Sanierung durch ein Kupferblechdach. Gleichzeitig wurde die Hütte mit der Installation einer Photovoltaik- und einer thermischenSolaranlage auf den neuesten Stand der Umwelttechnik gebracht.
Zur Gamshütte kann man entweder von Finkenberg oder von Ginzling (Gamsgrube) aufsteigen. Sie ist entweder die erste oder letzte Station des beliebten Berliner Höhenweges.
Die Kasseler Hütte – 2177m

Die Kasseler Hütte liegt am Talschluss der Stilluppe und gehört der Sektion Kassel. Schon 1895 entstand in der Rieserfernergruppe in Südtirol eine Kassler Hütte, die jedoch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Zuge der Enteignung vom Club Alpino Italiano übernommen und in Hochgallhütte umbenannt wurde. 
Auf der Suche nach einem neuen Hüttenplatz fiel die Wahl auf den Stilluppgrund, wo 1927 die neue Kasseler Hütte feierlich eröffnet wurde. Die Hütte umfasst 14 Betten, 68 Matratzenlager im Dachgeschoß, Gastzimmer, Führerraum, Küche und Wohnung für die Hüttenwirte im Erdgeschoß.
In den folgenden Jahren brachten Modernisierungsarbeiten, wie der Bau einer Turbinenanlage zur Stromerzeugung, oder die Errichtung einer Matrialseilbahn Erleichterungen für die Hüttenbewirtschaftung. Umfangreiche Erweiterungsarbeiten setzten 1981 ein, um der stetig steigenden Besucheranzahl gewachsen zu sein.
Die Kasseler Hütte erreicht man mit Shuttlebussen ab Mayrhofen. Sie fahren bis zur Grüne Wand Hütte im hintersten Stilluptal. Von dort führt ein angenehmer Steig in ca. 2 Stunden zur Hütte hinauf.
Die ZittauerHütte – 2328m
Die Sektion Warnsdorf wählte diesen malerischen Platz am unteren Gerlossee im Wildgerlostal im Jahre 1900 aus und began gleich die Hütte und die dazugehörigen Wege zu bauen. 
Die Hütte entsprach den damaligen Bauten des Alpenvereins, sie bot 6 Schlafräume mit 10 Betten, 8 Lager für Bergsteiger und 6 Bergführerlager und konnten 1901 eingeweiht werden. Die Hütte wurde zu Ehren der größten Gruppe der Vereinsmitglieder aus Zittau in Sachsen als “Zittauer Hütte” benannt.

Geschichte: ZittauerHütte
Schon wenige Jahre nach der Eröffnung durfte man sich über prominente Gäste erfreuen, König Friedrich August von Sachsen stattete der Zittauer Hütte 1913 einen Besuch ab. In den ersten Jahren nach der Eröffnung der Hütte kamen pro Jahr nur einige hundert Besucher. Der Grund war der lange und beschwerliche Anmarsch von Krimml. Dies änderte sich deutlich mit dem Bau der Gerlosstraße 1930, sowie mit dem Ausbau 1962.
In den letzten 100 Jahren wurde die Hütte immer wieder aus- und umgebaut. 1967 wurde die Materialseilbahn errichtet, 1987 ein Kleinkraftwerk, 1997 eine Abwasseranlage und 2001 erfolgte eine Komplettsanierung und Erweiterung.
Warnsdorf liegt in der grenzübergreifenden Region der Sudeten und bereits zum Zeitpunkt des Hüttenbaues umfasste die Sektion Warnsdorf Mitglieder sowohl aus Böhmen, als auch aus Sachsen. Nach dem ersten Weltkrieg wurde das Sudetenland der Tschcheslowakei zugesprochen.
Der Aufstieg zur ZittauerHütte
Der Aufstieg zur Zittauerhütte beginnt beim Alpengasthof Finkau im Wildgerlostal führt zuerst taleinwärts vorbei an der Trisselalm bis zur letzten großen Steilstufe unter der Reichenspitze und quert dann hinüber zum unteren Gerlossee bzw. zur Hütte. Insgesamt braucht man etwa 3 Stunden.
Die PlauenerHütte im Zillergrund – 2363m
Die Plauener Hütte liegt im Kuchelmooskar im Zillergründl hoch über dem gleichnamigen Speichersee zu Füßen der vergletscherten Gipfel der Reichenspitzgruppe.
Es war die 1883 gegründete Sektion Plauen-Vogtland, die 1899 die Plauener Hütte als einfache Unterkunft für Bergsteiger errichtete. Steigende Besucherzahlen erforderten 1912 und 1925 eine Erweiterung der Hütte. Das heutige Gesicht erhielt die Schutzhütte 1985-1986 durch umfangreiche Zubauten im Zuge einer Modernisierung. Weitere Sanierungsmaßnahmen zur Strom- und Wasserversorgung gab es ab dem Jahr 2009.
Die Besitzverhältnisse der Plauener Hütte stellen eine Besonderheit dar. Sie ist die einzige Hütte einer ostdeutschen Sektion, welche die DDR Zeit ohne Besitzerwechsel überstanden hat. Nach der verordneten Auflösung der Sektion Plauen 1945 ging die Schutzhütte in die Verwaltung der Sektion Zillertal über. Mit der Wiedergründung der Sektion Plauen neun Jahre spatter im Westen Deutschlands setzten die Bemühungen ein, die Hütte wieder in die Sektion zurückzuführen, was 1958 geschah. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands erfolgte 1995 die Rückkehr des Sitzes der Sektion in ihre Heimatstadt Plauen. 
Somit ist Plauen die erste ostdeutsche Sektion, die ihre Hütte in den Alpen wieder zurückerhalten hat. 
Durch den Kraftwerksbau im Zillergründl ist die Plauener Hütte heute bequem mit einem Linienbus bis zur Staumauerkrone mit anschließendem 1½ stündigen Hüttenaufstieg erreichbar.
Die GreizerHütte – 2226m
Hoch über dem Floitengrund im Grießfeld am Fuß des Großen Löfflers liegt die Greizer Hütte.
Den Hüttenplatz wählte die Sektion Greiz, um 1893 eine Hütte mit der Größe von 8,4 x 4,2m ohne feste Bewirtschaftung zu errichten. Das aus Bruchsteinen erbaute und innen mit Holz getäfelte Gebäude enthielt im Erdgeschoß ein Zimmer mit Herd und 5 Betten sowie ein Damenzimmer mit 2 Betten, im Dachgeschoß ein Zimmer mit 5 Betten und Heulager für 5 Personen. Das erwachende Ineresse am Alpinismus erforderte bereits nach drei Jahren die Einsetzung eines festen Hüttenwirtes und in Folge mehrere Um- und Anbauten in den Jahren 1905 und 1927-1928. Seit 1925 ergänzte eine Winterhütte, errichtet für Winterbesucher und für die Unterbringung der Saumpferde, das Angebot der Greizer Hütte.

Diese Hütte wurde 1998 durch einen Neubau ersetzt. Umfassende Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten zu Beginn der 1970er Jahre verliehen der Schutzhütte das heutige Aussehen. Sie verfügt jetzt über 20 Betten und 58 Matratzenlager.
Die Versorgung der Greizer Hütte gestaltete sich in den ersten drei Jahrzehnten äußers mühevoll – alle benötigten Güter mussten zur Hütte getragen werden. Der Einsatz von Saumtieren ab 1912 brachte gegenüber dem vorhergehenden Zustand eine spürbare Besserung. Der Ausgangspunkt der Säumerei lag geraume Zeit in Ginzling , bis ein zur Bockachalm geschaffener Fahrweg die zu säumende Strecke wesentlich verkürzte. Im Jahre 2002 wurde die Materialseilbahn zur Hütte gebaut und die Versorgung durch die Pferde eingestellt.
Das Furtschaglhaus in Dornauberg – 2295m
Diese Hütte liegt im innersten Schlegeisgrund und bietet einen herrlichen Blick auf das zerklüftete Schlegeiskees mit dem Hochfeiler (3509m) und dem Großen Möseler (3480m).
Die Schutzhütte ist die zweite von der Sektion Berlin erbaute Hütte in den Zillertaler Alpen. 
Als das Furtschaglhaus 1889 eröffnet wurde, bot sie im Erdgeschoß ein Speisezimmer, eine Küche, ein Herrenschlafgemach mit 12 Matratzenlagern und ein Damenschlafzimmer mit 4 Betten. Im Dachgeschoß befanden sich die Kammer für die Hüttenwirtin, eine Stube mit zwei Lager und Heulager für 15 Bergsteiger. Im ersten Wirtschaftjahr zählte man 158 Nächtigungsgäste und 10 Jahre spatter konnten schon über 1000 Nächtigungen verbucht werden. Steigende Besucherzahlen erforderten 1912 eine Erweiterung des Furtschaglhauses, dessen Erscheinungsbild in den folgenden sieben Jahrzehnten kaum verändert wurde.
Zu den Hüttenwirten des Furtschaglhauses zählt der Bergführer Alfons Hörhager, der die Hütte von 1901 – 1956 bewirtschaftete. Er steht als Beispiel für viele Hüttenwirte im Zillertal, deren Familien oftmals über Generationen hinweg “ihre” Hütte liebevoll und sorgsam bewirtschafteten.
Im Jahre 1992 schloss man eine fast 10 Jahre andauernde Sanierung ab und errichtete 2003 ein neuesWasserkraftwerk zur Energieversorgung.
Das Furtschaglhaus verfügt heute über 120 Schlafplätze (Zimmer und Matratzenlager). Die Hütte wird mit Hilfe einer Materialseilbahn versorgt.
Bis zumSchlegeisspeicher (1790m) kann man bequem mit dem Auto fahren. Der Gehweg längs des Sees ist eine einfache Wanderung und auch der anschließende Serpentinenanstieg erfordert lediglich ein wenig Ausdauer.
Die Olpererhütte der Sektion Neumarkt– 2389m
Sie liegt im Riepenkar über dem Zamser Grund mit dem türkisblauen Speichersee Schlegeis zu ihren Füßen und dem mächtigen Olperer und Gefrorene Wand Spitzen im Hintergrund.
Geschichte OlpererHütte
1880 erhielt die Sektion Prag den für den Hüttenbau erforderlichen Grund von drei Pfitscher Bauern kostenlos, da sich die Sektion Prag im Gegenzug zu einer Sanierung von Wegen verpflichtete. Die Bauarbeiten begannen Ende August und mussten wegen anhaltend schlechtenWetters im September eingestellt werden.
Die Olperer Hütte wurde 1881 gebaut und ist nach der Berliner Hütte (1879) die zweitältste Alpenvereinshütte in den Zillertaler Alpen. Sie wurde ebenso aus Steinen errichtet und innen vertäfelt. Ursprünglich hatte sie als Einraumhütte auf dem Dachboden acht Matratzen- und acht Heulager.
Im Erdgeschoß stand ein eiserner Kochherd, dessen Rauchgase über ein Ofenrohr durch die Giebelwand nach draußen geführt wurden. Die Bergsteiger mussten Feuerholz und Lebensmittel zu ihrer Versorgung selbst mitnehmen. Die Ausstattung der Hütte entsprach dem damals üblichen Standard. Im Jahre 1900 wurde die Hütte an die Sektion Berlin als Selbstversorgerhütte verkauft. 1933 errhielt die Hütte durch einen bergseitigen Zubau eine separate Küche und weitere Übernachtungsplätze im Obergeschoß. Seit dem wurde die Hütte bewirtschaftet. 1937 wurde ein Stall für ein Pferd und zwei Ziegen sowie ein Brennholzlager angebaut, um den Wirtschaftsbetrieb zu erleichtern. 
1972 hat man diesen angebauten Stall zu einem Sanitätsraum erweitert. 1976 wurden eine zusätzliche Gaststube und moderne Sanitäranlagen eingebaut. Im Sommer 1998 wurde die Olpererhütte und die dazugehörigen Weganlagen von schweren Unwettern heimgesucht und durch eine Gerölllawine beschädigt. 2004 gelang es, die Hütte an die Sektion Neumarkt – Oberpfalz zu verkaufen, da eine grundlegende Sanierung anstand. Man beschloss, die alte Hütte komplett abzureisen und durch einen Neubau zu ersetzen. 2006 war der Abriss beendet und Ende Juni 2008 wurde die neue Olperer Hütte fertiggestellt.
Sie gilt heute als Vorzeigewerk neuer alpine Hüttenarchitektur.
Die denkmalgeschütze Berliner Hütte im Zemmgrund - 2044m
Vor dem Bau der Berliner Hütte diente die Alpe Schwarzenstein als Unterkunftsstätte für die Steinklauber, die sich, wie berichtet wird, „in der Gegend herumtrieben“. Von dort aus konnte man nach wenigen Minuten an das Ende des Hornkeeses (früher auch als Horner Ferner bezeichnet) gelangen. Hier wurde den Touristen eine besondere Attraktion geboten.

Bereits 1898 wurde von Jakob Pfister ein ca. 50m langer und 8m hoher Gang in das ewige Eis gegraben. Mittlerweile hat dieser Gletscher ein paar hundert Meter an Länge verloren.

Im Jahre 1869 wurde die Alpenvereinssektion Berlin gegründet und 1875 überlegte man den Bau einer Hütte in den Alpen. Eine Abordnung entschied sich für einen Hüttenbau auf der Alpe Schwarzenstein. Die Sektion Berlin durfte das Grundstück nicht kaufen, da sie nicht rechtsfähig war, so erwarb ein Mitglied der Hüttenkommission das Gelände eben privat. Der Baumeister Johann Hotter aus Mayrhofen begann 1878 mit dem 6 x 10m aus Trockenmauerwerk aufgesetzten Gebäude, das zur Selbstversorgung ausgelegt war. Bretterwände aus Zirbenholz unterteilten den Damen- und Herrenschlafraum, sowie die Wohnküche und einige Heulager im Dachgeschoß.

Am 28. Juli 1879 wurde diese erste Schutzhütte in den Zillertaler Alpen eingeweiht. Bereits nach zwei Jahren war das Grundstück und Gebäude durch die gute Frequentierung durch zahlreiche Besucher schuldenfrei. 1882 erfolgte der Ausbau des ursprünglichen Almsteiges zu einem Saumpfad, welcher weitere Besucher brachte. In diesem Zuge wurde sicher auch der Steig durch die Klamm neu angelegt. Der alte Steig führte bei Klammbeginn weit hinauf – querte weit oben den Felsbereich und führte am Klammende wieder herunter.
Der Besucherandrang muss gewaltig gewesen sein, denn die Hütte bekam ab 1883 sogar einen Pächter, der in den Folgejahren (1885, 1892, 1899 und 1911) am ursprünglichen Gebäude an-, um- und zugebaut hat.
Die ersten Hütten im Zillertal boten durchwegs nur einfache Unterkünfte, jedoch keinen Komfort, aber die Berliner Hütte scheint schon 1887 aus der Rolle gefallen zu sein. Darüber wird launisch vermerkt: "Die Berliner Hütte hat Nachttöpfe und einen Abort, dieser noch dazu eine herrliche Aussicht. Die Dominikus-Hütte hat nur Nachttöpfe und die Olperer-Hütte weder das eine, noch das andere". Mittlerweile herrschen aber auf jeder Hütte in den Zillertaler Alpen einwandfreie sanitäre Zustände.
1898 bekam die Hütte einen eigenen Telefonanschluss über eine Freileitung, die von Ginzling herauf führte, 1900 eine Dunkelkammer für die Entwicklung von Fotomaterial, 1906 sogar ein eigenes Postamt und 1908 eine Schuhmacherwerkstatt. 1909/10 wurde das sogenannte Haupthaus errichtet, somit bot die Berliner Hütte drei Speiseräume (einen mit Panoramafenster), rote Teppiche und über 63 Zimmer mit 100 Betten und 20 Matrazenlagern, sowie Unterkunfsräume für 20 Dienstboten. 1910 wurde das Wasserkraftwerk zur Stromerzeugung fertiggestellt. Somit konnten die Speisesäle und teilweise auch Zimmer beheizt werden. Durch die vielen Investitionen entwickelte sich ein “Stück Berlin in den Alpen”. Diese Hütte ist ein eindrucksvolles Zeugnis aus jener Zeit, als das Deutsche und dessen Hauptstadt sich mit Glanz und Gloria auch im Hochgebirge darstellen musste.
Seit 1997 ist die Berliner Hütte nicht zuletzt wegen ihres einmaligen Speisesaales eine denkmalgeschütze Alpenvereinshütte.
Geschichte: Berliner Hütte
Die Berliner Hütte während der Weltkriege
Im Jahre 1915 wurden 600 Soldaten auf der Berliner Hütte stationiert. 1921 – 1925 wurde knapp unterhalb der Hütte ein Kriegerdenkmal errichtet. 1931 war die Hütte zum ersten Mal im Winter (Feber – April) für Schibergsteiger geöffnet. Auch während des zweitenWeltkrieges wurden bei dieser Hütte Hochgebirgsausbildungen für die Soldaten durchgeführt.
Während des zweiten Weltkrieges wurden im Zemmgrund in den Sommermonaten Pferde, die man für den Kriegsdienst brauchte, im Bereich der Waxeggalm für das Hochgebirge ausgebildet. So mancher Ginzlinger hatte in dieser Zeit den Bauch nicht immer voll und schon gar nicht Fleisch auf seinem Speisezettel. Also verschwand immer wieder einmal ein Pferd aus dem staatlichen Eigentum auf „mysteriöse Weise“. Die zuständigen Hirten blickten wohl hinter dieses Mysterium und machten jedesmal eine leicht erklärbare Meldung an das Militärkommando: „Pferd abgestürzt.“ Nun häuften sich aber diese Vorkommnisse und man verlangte als Beweis die „Decke“ (Haut) des Pferdes, um die vielleicht vorgetäuschten Unfälle aufzuklären.
Das Aufsichtspersonal für den Pferdebestand war jedoch schlau genug, um nicht in diese Falle zu tappen und gab zukünftig die Meldung weiter: „Pferd samt Decke in Schlucht abgestürzt.“
In den 1970er Jahren bauten die Besitzer der Alpenrose und Waxeggalm den Steig durch die Klamm sukzessive zu einem Fahrweg aus. Die Belieferung hinauf zur Berliner Hütte erfolgte jedoch weiterhin mit Pferden, weil sich die Sektion Berlin nicht an den Kosten für Ausbau und Erhaltung beteiligte und daher für die Pächter ein Befahrungsverbot bestand. 1998 wurde am Wegende eine Materialseilbahn zur Berliner Hütte gebaut.
Mittlerweile verfügt die Berliner Hütte über 180 Übernachtungsplätze.
Das Jöchlhaus in Madzeit - Tux
Historische Wurzeln spüren im "Jöchlhaus"
Über 600 Jahre zählt das "Alte Jöchlhaus" und somit zu den ältesten Bauernhäusern in Nordtirol. Es ist bis in die heutige Zeit durchgehend bewohnt gewesen, wodurch es über die Jahrhunderte lebendig geblieben ist und seine einmalige Atmosphäre bewahrt hat.
Die Geschichte der Alpen, Kunst und Kultur begegnen sich im "Alten Jöchlhaus". Im urigen "Zirbennest" unter dem Schindeldach veranstaltet der Verein "Das Alte Haus" Ausstellungen, Vorträge und Workshops.

Eine zauberhauft-mystische Welt
Die Ausstellung "Die Kristalle der Steinzeitjäger" zeigt einige der schönsten erst im Jahr 2000 am 2800 Meter hoch gelegenen Riepenkar entdeckten Artefakte und versetzt damit die Besucher zurück in die Zeit, als es in den Alpen noch kein sesshaftes Leben gegeben hat, in die mythische Vorzeit vor 11.000 Jahren - in die Mittelsteinzeit. Zudem beherbergt das "Alte Haus" eine Galerie, deren Bilder den Zauber der Berge auf Leinwand bannen – sei's mit der Kamera oder mit Farbe und Pinsel. Zu sehen gibt's märchenhafte Landschaften, mystische Sagengestalten, bunte Almwiesen sowie kristallklare Alpenseen und -bäche.
Märchenhafte Alpenreisen
Eine fantastische Reise zu den Wurzeln der ältesten Alpensagen kann mit Jutta Fankhausers Buch "Kristallfunkeln – Als der Wilde Alber erwachte" begangen und miterlebt werden, wie Arneor, der Magier, aus dem Reich der Saligen aufbricht und sich auf die Suche nach dem mystischen Bergkristall vom Olperer begibt. Illustriert ist das Buch mit Fotografien von J. P. Fankhauser und Gemälden von Kari. Die beiden Illustratoren bebilderten ebenfalls bereits Jutta Fankhausers erste Publikation aus dem "Alten Haus", den Band "Einhundertelf Zillertaler Krapfen – Eine sagenhafte Alpenreise", der hineinführt in die Sagen- und Mythenwelt der Alpen. So steht – dem Volksglauben nach – in den winterlichen Rauhnächten das Geisterreich offen, und die "Wilde Jagd" zieht über Berg und Tal. Von einem Mitglied dieses Geisterzugs handelt die Geschichte, nämlich vom "kleinen, struppigen Teufel", der in der letzten Rauhnacht die Rückkehr ins Geisterreich verpasst, weil er dem Duft von "Zillertaler Krapfen" nicht widerstehen kann. Nun muss er ein Jahr in den Alpen verbringen, wobei er uralten Sagengestalten begegnet, den Zauber des Almsommers erlebt und immer wieder den Verlockungen der traditionellen Alpenküche erliegt. Eine Geschichte für Groß und Klein, für alle, die die Alpen lieben und ein Stück von ihrer Magie mit nach Hause nehmen möchten.
Hinein ins "Alte Jöchlhaus"
Geöffnet ab Juli immer mittwochs 15.00 Uhr und donnerstags 10.30 Uhr. Wunschtermine: 05287/87668, office@dasaltehaus.at, eine Führung dauert ca. eine Stunde. Gruppen ab zehn Personen auf Anfrage. Ein Besuch in der Galerie ist jederzeit möglich (bitte klopfen oder am besten vorher anrufen).
Zudem gibt‘s jeden Donnerstag, 16.30 Uhr, die beliebte Sagenstunde „Mythen der Alpen“ in der urigen Küche, im Mai und Juni gibt es die Sagenstunde auf Anfrage ab vier Personen.
Quellen:
Die Zillertalbahn ist immer eine Reise wert
Original, Attraktion, Notwendigkeit
Auf einer 32 Kilometer langen Strecke und über 35 Brücken führt sie durchs "aktivste Tal der Welt" – die Zillertalbahn. Und dies treu seit über 100 Jahren.
 1863 war's, als noch ein Pferdegespann täglich dreimal die Strecke nach Mayrhofen befuhr und sich herausstellte, dass dieser Stellwagenbetrieb – der übrigens trotz Bahn noch bis 1902 beibehalten wurde und bei dem Reisende sogar in Zell übernachten mussten - dem Verkehr nun nicht mehr gewachsen war. Doch es dauerte noch bis 1892, bis sich alle Gemeindevorsteher und weitere Persönlichkeiten des Tales versammelten und ein Bahnkomitee wählten. Drei Jahre später wurde schließlich der Eisenbahnbau beschlossen, und nochmal drei Jahre vergingen, bis mehrere Projekte zur Auswahl standen und das nötige Stammkapital erreicht worden war.
1863 war's, als noch ein Pferdegespann täglich dreimal die Strecke nach Mayrhofen befuhr und sich herausstellte, dass dieser Stellwagenbetrieb – der übrigens trotz Bahn noch bis 1902 beibehalten wurde und bei dem Reisende sogar in Zell übernachten mussten - dem Verkehr nun nicht mehr gewachsen war. Doch es dauerte noch bis 1892, bis sich alle Gemeindevorsteher und weitere Persönlichkeiten des Tales versammelten und ein Bahnkomitee wählten. Drei Jahre später wurde schließlich der Eisenbahnbau beschlossen, und nochmal drei Jahre vergingen, bis mehrere Projekte zur Auswahl standen und das nötige Stammkapital erreicht worden war.
Dann, im Dezember 1899, erhielten die Konzessionswerber vom damaligen k.k. Eisenbahnminister Heinrich von Wittek die ersehnte "Concessions-Urkunde" und gründeten noch im selben Monat die "Zillerthalbahn Actiengesellschaft". Gewählt wurde – aus wirtschaftlichen wie wehrtechnischen Gründen - die Schmalspur mit 760 mm Weite. Ein Jahr darauf war die Bahn bis Fügen fertiggestellt, 1901 wurde die Strecke erst bis Kaltenbach und dann bis Zell weitergeführt, im Juli 1902 schließlich bis Mayrhofen. Die Bahn besaß zwei Lokomotiven, zehn Personen- sowie 22 Güter- und Postwagen. 118.000 Personen konnten bereits im ersten Betriebsjahr befördert werden, rund 50 Jahre später stieg die Zahl auf 600.000.
Durch Bautransporte gerettet
Die gute Wirtschaftslage brachte es mit sich, dass die Zillertalbahn als Österreichs erste Schmalspurbahn im Jahr 1921 mit einem Triebwagen mit Dieselmotor-Antrieb (VT) ausgestattet werden konnte. Von 1928 bis zur Einstellung des Werkes 1976 war der Magnesitabbau in Tux wirtschaftlich die wichtigste Grundlage für die Bahn. 1935 wurde der Autobus-Linienverkehr zwischen Mayrhofen und Innsbruck eingeführt.
Im Juli 1956 wurde die "Zillertalbahn AG" in "Zillertaler Verkehrsbetriebe AG" umbenannt. Nach zwei schwierigen Jahren – die Bahn musste beinahe einem Straßenbau weichen - übernahm die Bahn 1965 die Transporte des Baubedarfs zur Errichtung der Zemmkraftwerke. Rollwagen, zwei neue Diesellokomotiven wurden angeschafft, der Zugfunk eingeführt. 1977 eröffnete die Zillertalbahn ein eigenes Reisebüro. Die Zementtransporte für den Bau des Speicherkraftwerks Zillergrund brachten 1979 einen zusätzlichen Aufschwung. 1980 finanzierten Bund, Land Tirol, die Gemeinde Jenbach sowie die Zillertaler Gemeinden ein erstes Investitionsprogramm zur Erneuerung des Fuhrparks und Fahrweges. Vier Jahre darauf begann mit dem Ankauf von zwei neuen dieselelektrischen Triebwagen, vier Personenwagen und eines Dienstwagens ein neuer Abschnitt im Personenverkehr. Das Bahnbetriebswerk am Bahnhof Jenbach wurde 1989 neu erbaut, 1991 der Taktverkehr eingeführt. 13 Zugpaare wurden nun im Stundentakt angeboten, verdichtet durch die Linienbusse zur halben Stunde. Seit der Ausgliederung aus dem Taktverkehr 1993 wurde – und wird bis heute – der Dampfzug nur mehr in eigenem Regelbetrieb als "nostalgischer Bummelzug" eingesetzt.
Stete Weiterentwicklung
 1995 brachte weitere Änderungen: Die Reparatur- und Servicewerkstätte für den Busbetrieb wurde neu erbaut, zwei neue Triebwägen wurden in Betrieb genommen – zwei weitere 1998 -, die Zillertaler Verkehrsbetriebe AG wurde Partner im Verkehrsverbund Tirol. 1999 wurde auf dem Landhausplatz Innsbruck der "Kristallwagon", ein Gesellschaftswagen für Festivitäten, vorgestellt – ein Geschenk zur bevorstehenden 100-Jahr-Feier.
1995 brachte weitere Änderungen: Die Reparatur- und Servicewerkstätte für den Busbetrieb wurde neu erbaut, zwei neue Triebwägen wurden in Betrieb genommen – zwei weitere 1998 -, die Zillertaler Verkehrsbetriebe AG wurde Partner im Verkehrsverbund Tirol. 1999 wurde auf dem Landhausplatz Innsbruck der "Kristallwagon", ein Gesellschaftswagen für Festivitäten, vorgestellt – ein Geschenk zur bevorstehenden 100-Jahr-Feier.
Im Jahr 2000 expandierten die Holztransporte auf 440.000 t und stellten somit die höchste Gütermenge dar, die jemals auf der Zillertalbahn transportiert worden war. 2001 wurde mit dem Bau der neuen Innbrücke begonnen. 2002 verkehrten die Triebwagenzüge mittlerweile mit 70 km/h über funkgesteuerte Weichen, bedient von einer computergesteuerten Funkleitstelle. Zwei neue Loks wurden angeschafft, die Zahl der beförderten Fahrgäste kletterte auf 1, 7 Mio., bei Linienbussen auf 1,1 Mio. Im Jahr darauf wurde die Rotholzer Innbrücke fertiggestellt und eröffnet, im September erfolgten Einweihung und Übergabe des Bahnhofs Uderns an die Lebenshilfe. Drei Steuerwagen, fünf Mittelwagen und zwei weitere Diesellokomotiven wurden 2005 angekauft, im Jahr drauf wurde die Busflotte um vier neue Niederflurbusse aufgestockt. In den nächsten Jahren wurde weiter modernisiert, 2008 erfolgte in Kaltenbach der Spatenstich zum zweigleisigen Bau des zweiten Abschnitts Kaltenbach-Aschau, 2009 wurde ein digitales Fahrgastinformationssystem eingeführt.
Am Zillertalbahnhof in Jenbach entstand 2010 eine neue Anlage zur besseren Verknüpfung des öffentlichen Nahverkehrs von Bus und Bahn. 2011 erhielt die Zillertalbahn für den zweigleisigen Ausbau den VCÖ-Mobilitätspreis der Kategorie "Infrastrukturen für multimodale Mobilität", 2012 in drei Einzelkategorien den "Sommer-Award-Preis" des internationalen Skiarea-Tests, nämlich für die "freundlichsten Zugführer", das "freundlichste Bahnhofspersonal" und den "Innovationspreis für Tradition & Nostalgie". Im April des darauffolgenden Jahres fand die feierliche Übergabe der zweigleisig ausgebauten Streckenabschnitte Kaltenbach-Aschau und Zell-Ramsau statt, außerdem die des ÖV-Knotens Kaltenbach. Im Juni folgte die Übergabe des barrierefreien ÖPNV-Knotens beim Zillertalbahnhof Jenbach an die Fahrgäste. In Zuge der Fertigstellung der neuen Bedarfshaltestelle Rotholz erfolgte ebenfalls eine Weichenverlegung.
 Zukunft bereits eingeläutet
Zukunft bereits eingeläutet
Heute ist die Zillertalbahn nicht mehr wegzudenken – ob für Pendler oder Touristen, ob Triebwagengarnituren oder lokbespannte Wendezüge. Rund 2,4 Mio. Fahrgäste werden im Schienennahverkehr befördert, ca. 43.000 Fahrgäste im Dampfzugbetrieb. Und es geht schon mal so richtig hoch her und "dampfend" durchs Tal - sei's ganz im Zeichen der Mamis am Muttertag, zünftig auf dem "Dampfzug mit Musik", genussreich zum Dampfzug-Saisonausklang im "Erntedampfzug" oder in ausgelassener Feierlaune auf dem traditionellen Silvesterzug.
Enwicklung, Verbesserung und Zeitgeist sind auch künftig Thema. Als erste Schmalspurbahn der Welt soll die Zillertalbahn ab dem Jahr 2022 mit Wasserstoff fahren. Laut LH Günther Platter "ein glänzendes Vorbild für die Vereinbarkeit von umweltfreundlicher und moderner Mobilität und nachhaltigem Tourismus". Der Umstieg auf "grünen Wasserstoff" soll unter anderem ein Beitrag zur Energieautonomie sein.
Quelle:
http://www.zillertalbahn.at
Das Strasserhäusl in Laimach im Zillertal
Ein nostalgisches Kleinod mit historischem Flair
Einst beherbergte das "Strasserhäusl" die "Geschwister Strasser aus dem Zillerthale"
"Hier lebten die Strasser Kinder, welche im Jahre 1832 das Lied 'Stille Nacht, Heilige Nacht' nach Leipzig und damit in die Welt brachten", ist auf einer Tafel im 1714 erbauten "Strasserhäusl" in Hippach/Laimach zu lesen. Das Museum, das mittlerweile unter Denkmalschutz steht, hat eine ganz eigene, besondere Geschichte zu erzählen, ist es doch das Elternhaus der Geschwister Strasser, die d a s Weihnachtslied als erste über Österreichs Grenzen hinausgetragen haben.
 Die Not war es, welche die Geschwister Amalia, Anna, Karolina und Josef Strasser 1831 veranlasste, sich auf den langen Weg nach Leipzig zu machen, um sich dort auf dem Weihnachtsmarkt als Handschuhhändler zu verdingen. Mit im Gepäck außerdem heimatliche Lieder, mit denen sie sich in Gasthäusern einen Schlafplatz und Verpflegung ersangen, und – das Lied "Stille Nacht! Heilige Nacht!".
Die Not war es, welche die Geschwister Amalia, Anna, Karolina und Josef Strasser 1831 veranlasste, sich auf den langen Weg nach Leipzig zu machen, um sich dort auf dem Weihnachtsmarkt als Handschuhhändler zu verdingen. Mit im Gepäck außerdem heimatliche Lieder, mit denen sie sich in Gasthäusern einen Schlafplatz und Verpflegung ersangen, und – das Lied "Stille Nacht! Heilige Nacht!".
Dieses brachte einst der Fügener Orgelbauer Carl Mauracher aus Salzburg ins Zillertal mit. Als es die Ur-Rainer-Sänger im Fügener Schloss anlässlich eines Besuchs von Graf Dönhoff und Kaiser Franz I vortrugen, hörten es auch die Strasser-Kinder und waren fasziniert davon.  Sie verliehen dem Lied ihre eigene Note. Denn durch ihre dreistrophige Fassung wurde "Stille Nacht" als "Volkslied aus dem Tiroler Zillerthale" weltbekannt. Die Aufzeichnung des Liedes in Leipzig und dessen Verbreitung rund um Leipzig mittels Verlag A. R. Friese sowie deutscher Schulgesangsbücher belegen dies. Folgende Auftritte der Rainer-Sänger führten schließlich bis nach Amerika und verbreiteten das Lied weiter.
Sie verliehen dem Lied ihre eigene Note. Denn durch ihre dreistrophige Fassung wurde "Stille Nacht" als "Volkslied aus dem Tiroler Zillerthale" weltbekannt. Die Aufzeichnung des Liedes in Leipzig und dessen Verbreitung rund um Leipzig mittels Verlag A. R. Friese sowie deutscher Schulgesangsbücher belegen dies. Folgende Auftritte der Rainer-Sänger führten schließlich bis nach Amerika und verbreiteten das Lied weiter.
Die aus dem Jahr 1818 ursprüngliche sechsstrophige Salzburger Originalfassung von Komponist Franz Xaver Gruber und Autor Joseph Mohr wurde 2011 von der UNESCO als "Immaterielles Kulturerbe" in Österreich anerkannt.
Als wäre die Zeit stehengeblieben
 Neben der Geschichte der Strasserkinder mit Abbildungen der Familie, Original-Noten und ebenfalls noch Handschuhen aus dieser Zeit, teilt der uralte Holzblockbau des Strasserhäusls mit seinen rauchgeschwärzten Balken, Butzenscheiben und Türbeschlägen noch mehr mit. Die alte Stube mit Walzenofen und Herrgottswinkel, die dunkle Rauchkuchl, die Schlafzimmer mit karierter Bettwäsche und Nachttopf, das Plumsklo, alte Arbeitsutensilien sowie von Hand hergestellte Gerätschaften, die heimische Tracht und vieles mehr – all das erzählt vom damaligen kargen Leben der Zillertaler Bauern und so manchem fast schon vergessenen Handwerk. Dass so ein Stück Heimatgeschichte und Zillertaler bäuerliche Kultur weiterleben darf, ist der Verdienst von Rosa Kraft, die im Jahr 2000 das "Häusl" in ihre Obhut nahm und seitdem bis zu ihrem ableben liebevoll unzählige Orginal-Exponate gesammelt und gepflegt hat. Im Jahr 2020 ist das Musem wieder in das Eigentum der Gemeinde Hippach übergegangen.
Neben der Geschichte der Strasserkinder mit Abbildungen der Familie, Original-Noten und ebenfalls noch Handschuhen aus dieser Zeit, teilt der uralte Holzblockbau des Strasserhäusls mit seinen rauchgeschwärzten Balken, Butzenscheiben und Türbeschlägen noch mehr mit. Die alte Stube mit Walzenofen und Herrgottswinkel, die dunkle Rauchkuchl, die Schlafzimmer mit karierter Bettwäsche und Nachttopf, das Plumsklo, alte Arbeitsutensilien sowie von Hand hergestellte Gerätschaften, die heimische Tracht und vieles mehr – all das erzählt vom damaligen kargen Leben der Zillertaler Bauern und so manchem fast schon vergessenen Handwerk. Dass so ein Stück Heimatgeschichte und Zillertaler bäuerliche Kultur weiterleben darf, ist der Verdienst von Rosa Kraft, die im Jahr 2000 das "Häusl" in ihre Obhut nahm und seitdem bis zu ihrem ableben liebevoll unzählige Orginal-Exponate gesammelt und gepflegt hat. Im Jahr 2020 ist das Musem wieder in das Eigentum der Gemeinde Hippach übergegangen.
Die Schlegeis-Hochalpenstraße
Ein Erlebnis für Wanderer, Mountainbiker und Motorradfahrer
Hinein in eine sagenhafte Hochgebirgswelt führt die 13,3 Kilometer lange, kurvenreiche Schlegeis-Hochalpenstraße.
 Mit Start im 999 Meter hoch gelegenen Bergsteigerdorf Ginzling, vorbei an Wasserfällen und zahlreichen Aussichtspunkten, über acht Kehren und durch vier Natursteintunnel geht's hinauf auf 1.800 Meter Seehöhe, wo ein smaragdgrüner Stausee, der 126,5 Mio. m³ Wasser speichert, sowie ein Ausblick auf die Gletscher der höchsten Dreitausender in den Zillertaler Alpen Natur pur spüren lassen.
Mit Start im 999 Meter hoch gelegenen Bergsteigerdorf Ginzling, vorbei an Wasserfällen und zahlreichen Aussichtspunkten, über acht Kehren und durch vier Natursteintunnel geht's hinauf auf 1.800 Meter Seehöhe, wo ein smaragdgrüner Stausee, der 126,5 Mio. m³ Wasser speichert, sowie ein Ausblick auf die Gletscher der höchsten Dreitausender in den Zillertaler Alpen Natur pur spüren lassen.
Eine Staumauer zum "Bezwingen"
 Landschaftsprägend ist zudem die 131 Meter hohe und 725 Meter lange Staumauer, eine doppelt gekrümmte Bogengewichtsmauer, die längste Staumauer von VERBUND. Das Bauwerk kann zu Fuß überquert, als Aussichtspunkt genutzt oder von innen besichtigt werden. Zwischen Juni und Oktober werden vom Wasserkraftwerk-Betreiber Führungen angeboten, im Zuge derer die Besucher Interessantes über die technischen Kontroll- und Messeinrichtungen, über Stromproduktion aus Wasserkraft, über die Geschichte und Besonderheiten der Schlegeissperre sowie die Fauna und Flora rundherum erfahren können. Mehr Wissenswertes rund um die Stromerzeugung befindet sich im VERBUND-Informationszentrum neben dem Krafthaus in Mayrhofen. Die Ausstellung ist ganzjährig geöffnet, der Eintritt frei.
Landschaftsprägend ist zudem die 131 Meter hohe und 725 Meter lange Staumauer, eine doppelt gekrümmte Bogengewichtsmauer, die längste Staumauer von VERBUND. Das Bauwerk kann zu Fuß überquert, als Aussichtspunkt genutzt oder von innen besichtigt werden. Zwischen Juni und Oktober werden vom Wasserkraftwerk-Betreiber Führungen angeboten, im Zuge derer die Besucher Interessantes über die technischen Kontroll- und Messeinrichtungen, über Stromproduktion aus Wasserkraft, über die Geschichte und Besonderheiten der Schlegeissperre sowie die Fauna und Flora rundherum erfahren können. Mehr Wissenswertes rund um die Stromerzeugung befindet sich im VERBUND-Informationszentrum neben dem Krafthaus in Mayrhofen. Die Ausstellung ist ganzjährig geöffnet, der Eintritt frei.
Die Staumauer sportlich erleben lässt sich mit dem direkt auf der Mauer installierten Klettersteig, der mit leichtem Schwierigkeitsgrad auch für Anfänger geeignet ist. Abenteuerlich wird's mit dem neben dem Klettersteig befindlichen 600 Meter langen "Flying Fox", der 131 Meter hohen Abseilstation sowie verschiedenen Kletterrouten. Eine Ausrüstung kann vor Ort geliehen werden.
 Geöffnet ist ab ca. Mitte Mai, im Juni, September und Oktober täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr, im Juli und August täglich von 6.00 bis 18.00 Uhr.
Geöffnet ist ab ca. Mitte Mai, im Juni, September und Oktober täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr, im Juli und August täglich von 6.00 bis 18.00 Uhr.
Rund um den Schlegeis-Stausee erschließt sich auf 397 km² der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen und lädt mit ausgebauten Wanderwegen und Routen sowie Alm- und Schutzhütten zum Wandern und Tourengehen ein. Dabei finden Genusswanderer ebenso den richtigen Weg wie anspruchsvolle Alpinisten ihre Tour.
Quellen:
Museum in Zell
Den Hauch der Zeit spüren
Wohl einzigartig im ganzen Tal ist es gewesen, als 1991 der, wie ein Firstbaum belegt, 1713 in Schwendau erbaute Hof "Entoal" abgetragen und - mit der Sicherung einer gleichermaßen jahrhundertealten und kulturell wertvollen Bausubstanz – ab Herbst 1994 in Zell originalgetreu wiederaufgebaut worden ist. Seither wird im "Zillertaler Regionalmuseum" Geschichte dokumentiert und so mancher "Bund fürs Leben" geschlossen.
 Die letzte Besitzerin Rosina Tipotsch hat das Gebäude "Entoal" an den Kiwanis-Club Zillertal veräußert. Von diesem wiederum ist die Bausubstanz der Marktgemeinde Zell am Ziller überlassen worden. Die Geschicke des im Jahr 2000 gegründeten Museumsvereins Zillertal führt Obmann Peter Dolinseck.
Die letzte Besitzerin Rosina Tipotsch hat das Gebäude "Entoal" an den Kiwanis-Club Zillertal veräußert. Von diesem wiederum ist die Bausubstanz der Marktgemeinde Zell am Ziller überlassen worden. Die Geschicke des im Jahr 2000 gegründeten Museumsvereins Zillertal führt Obmann Peter Dolinseck.
Heute stellt der Hof "Entoal" das erste historische Objekt des Zillertaler Regionalmuseums dar, welchem eine Hauskapelle, ein Wirtschaftsgebäude in Form des aus dem Tuxertal stammenden "Löber-Stalles", ein originalgetreu nachgebauter Backofen und eine Brennhütte gefolgt sind. Ergänzt worden ist das Ensemble schließlich noch um einen Kornkasten, einen Brunnen, eine "Schupfe" (Unterstand) und den in der Vergangenheit bei jedem Gehöft üblichen Hausgarten. Fertiggestellt worden ist außerdem die "Wimpisinger-Stube" im Keller des Regionalmuseums. Der Stil des Raumes, der gegen Ende des 19. Jhd. entstand, wird landläufig als "Bauern-Barock" bezeichnet.
"Lebendes Museum"
 Alles andere als "verstaubt" geht es im Zillertaler Regionalmuseum zu. Anhand unterschiedlicher Exponate wird das einstige bäuerliche Leben und Arbeiten anschaulich dargestellt. Verschiedene Aktivitäten und Vorführungen alter, vielfach bereits in Vergessenheit geratener Handwerkskünste geben Einblick in den Alltag früherer Tage. So zeugt zum Beispiel ein alter Webstuhl, wie er bis Ende der Dreißigerjahre in nahezu jedem Bauernhaus zu finden gewesen ist, von der Zunft der (Leinen-, Loden- oder Teppich-) Weber. Immer wieder werden außerdem neue Ausstellungsschwerpunkte gesetzt.
Alles andere als "verstaubt" geht es im Zillertaler Regionalmuseum zu. Anhand unterschiedlicher Exponate wird das einstige bäuerliche Leben und Arbeiten anschaulich dargestellt. Verschiedene Aktivitäten und Vorführungen alter, vielfach bereits in Vergessenheit geratener Handwerkskünste geben Einblick in den Alltag früherer Tage. So zeugt zum Beispiel ein alter Webstuhl, wie er bis Ende der Dreißigerjahre in nahezu jedem Bauernhaus zu finden gewesen ist, von der Zunft der (Leinen-, Loden- oder Teppich-) Weber. Immer wieder werden außerdem neue Ausstellungsschwerpunkte gesetzt.
Geöffnet ist das „Zillertaler Regionalmuseum“ von Juni bis September Montag bis Freitag, 10.00 bis 16.00 Uhr. Anmeldungen für Gruppenführungen: 0664/1313787 oder 4408.
Tradition hat schon der Museumskirchtag, der jährlich am "Hohen Frauentag", den 15. August, am Museumsareal stattfindet. Im Juni 1996 gab sich das erste Paar in der über dreihundert Jahre alten Stube das "Jawort", mittlerweile finden regelmäßig standesamtliche Trauungen statt. Details und Infos: 05282/2222-25, standesamt@gemeinde-zell.at
Quelle:
Natur pur erleben im Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen
Naturjuwel, Ausgleichs- und Ruhezone
Ein "Naturpark im Hochgebirge" erstreckt sich vom rund 1000 m hoch gelegenen Bergsteigerdorf Ginzling - Dornauberg bis auf 3509 Höhenmeter am Hochfeiler. Ein Gebiet mit einer Fläche von über 2500 km², zwischen Reichenspitze im Osten, Olperer im Westen, Ahornspitze im Süden und Großen Möseler im Norden. Gemeinsam mit weiteren vier Schutzgebieten in Tirol bildet der Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen mit den größten Schutzgebietsverbund der Alpen.
 Mit dem Naturpark haben sich seit 1991 die Gemeinden Brandberg, Finkenberg, Mayrhofen, Tux sowie die Ortsvorstehung Ginzling auf mittlerweile 422 km² für den Schutz der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft im hinteren Zillertal entschlossen. Auslöser für das damalige "Ruhegebiet Zillertaler Hauptkamm" ist die geplante Autobahnverbindung Alemagna gewesen, die ebenso durchs Zillertal führen sollte. Mit der Verordnung des Ruhegebiets hat die Tiroler Landesregierung eine weitere Erschließung im Zillertal abwehren wollen. 2001 hat das Ruhegebiet unter dem neuen Namen Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen das Prädikat "Naturpark" erhalten.
Mit dem Naturpark haben sich seit 1991 die Gemeinden Brandberg, Finkenberg, Mayrhofen, Tux sowie die Ortsvorstehung Ginzling auf mittlerweile 422 km² für den Schutz der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft im hinteren Zillertal entschlossen. Auslöser für das damalige "Ruhegebiet Zillertaler Hauptkamm" ist die geplante Autobahnverbindung Alemagna gewesen, die ebenso durchs Zillertal führen sollte. Mit der Verordnung des Ruhegebiets hat die Tiroler Landesregierung eine weitere Erschließung im Zillertal abwehren wollen. 2001 hat das Ruhegebiet unter dem neuen Namen Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen das Prädikat "Naturpark" erhalten.
Organisatorisch wird der Naturpark von einem Verein mit den ordentlichen Mitgliedern, den Naturparkgemeinden, sowie der Umweltschutzabteilung des Landes Tirol, dem Österreichischen Alpenverein Sektion Zillertal und den Tourismusverbänden Mayrhofen-Hippach und Tux-Finkenberg getragen. Ziel ist es u. a., über den Naturpark Impulse für eine nachhaltige regionale Entwicklung zu setzen, um so die Wertschöpfung erhöhen wie die Lebensqualität sichern zu können.
Natur in den Lebensalltag integrieren
 Durch spezielle Angebote soll der Naturpark mit seiner Natur- und Kulturlandschaft wie deren Zusammenhänge bewusst und begreifbar gemacht werden. Besonders das Interesse von Kindern und Jugendlichen wird gezielt gefördert. So sind bereits die Volksschulen in Brandberg und Tux sowie die NMS Tux ausgewiesene Naturparkschulen, das heißt, Leitbild der Schule und Schulprofil sind mit den Inhalten, Zielen und Vorhaben des Naturparks abgestimmt. Naturpark und Schulen definieren gemeinsam Lernziele, aufbauend auf den vier Säulen: Schutz, Erholung, Bildung, Regionalentwicklung.
Durch spezielle Angebote soll der Naturpark mit seiner Natur- und Kulturlandschaft wie deren Zusammenhänge bewusst und begreifbar gemacht werden. Besonders das Interesse von Kindern und Jugendlichen wird gezielt gefördert. So sind bereits die Volksschulen in Brandberg und Tux sowie die NMS Tux ausgewiesene Naturparkschulen, das heißt, Leitbild der Schule und Schulprofil sind mit den Inhalten, Zielen und Vorhaben des Naturparks abgestimmt. Naturpark und Schulen definieren gemeinsam Lernziele, aufbauend auf den vier Säulen: Schutz, Erholung, Bildung, Regionalentwicklung.
Der Naturpark punktet mit verschiedenen Seitentälern, engen Schluchten, vergletscherten Gipfelregionen, gepflegter Kulturlandschaft und großer Artenvielfalt. Für herausragende Leistungen im Bereich der vier "Säulen" der Naturpark-Arbeit - Naturschutz, Bildung, Regionalentwicklung und Kommunikation - ist dem Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen vom Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) 2015 die Auszeichnung "Naturpark des Jahres" verliehen worden. Der Hochgebirgs-Naturpark hebt sich besonders durch innovative Projekte wie u. a. dem Naturpark-Ranger-Programm, den Freiwilligeneinsätzen und dem Engagement im schulischen sowie Umweltschutz-Bereich hervor.
Eintauchen in Tier- und Bergwelten, ins Früher und Heute
 Im 2008 in Ginzling errichteten Naturparkhaus befinden sich Büro, Info-Besucherzentrum mit der familiengerechten Erlebnisausstellung "Gletscher.Welten" sowie die öffentliche Naturpark- & Alpinbibliothek. Geöffnet ist bis 7. September täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr. Im bergbäuerlichen Kulturdenkmal Mitterstall befindet sich die Ausstellung „Brandberg – unsere Kulturlandschaft im Wandel“, die täglich bei freiem Eintritt besichtigt werden kann. Wissenswertes über den Steinbock, der im Zillertal eine lange Tradition hat, gibt's im Zillergrund in der Ausstellung "Steinbock.Welten" zu erfahren, geöffnet täglich von Juni bis September, Einritt frei. Von Juli bis September, gleichfalls bei freiem Eintritt, kann die Sonderausstellung „Pfitscher Joch grenzenlos“ auf der Lavitzalm im Zamsergrund begutachtet werden: Spannendes rund ums Joch, darunter unbekannte Hintergründe zur Frühgeschichte dieses alpinen Übergangs.
Im 2008 in Ginzling errichteten Naturparkhaus befinden sich Büro, Info-Besucherzentrum mit der familiengerechten Erlebnisausstellung "Gletscher.Welten" sowie die öffentliche Naturpark- & Alpinbibliothek. Geöffnet ist bis 7. September täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr. Im bergbäuerlichen Kulturdenkmal Mitterstall befindet sich die Ausstellung „Brandberg – unsere Kulturlandschaft im Wandel“, die täglich bei freiem Eintritt besichtigt werden kann. Wissenswertes über den Steinbock, der im Zillertal eine lange Tradition hat, gibt's im Zillergrund in der Ausstellung "Steinbock.Welten" zu erfahren, geöffnet täglich von Juni bis September, Einritt frei. Von Juli bis September, gleichfalls bei freiem Eintritt, kann die Sonderausstellung „Pfitscher Joch grenzenlos“ auf der Lavitzalm im Zamsergrund begutachtet werden: Spannendes rund ums Joch, darunter unbekannte Hintergründe zur Frühgeschichte dieses alpinen Übergangs.
Das über 300 Jahre alte, urige "s' Mehlerhaus" in Tux-Madseit beherbergt die Ausstellung „Olperer 150“, die sich der alpinen Geschichte und dem Naturraum des Gletscherberges widmet, der im Jahr 1867 erstbestiegen worden ist.
Aktiv die Natur erforschen
Im Rahmen des Naturpark-Sommerprogramms bieten elf Naturparkführer von Mai bis Oktober rund 250 Wanderungen zu über 30 verschiedenen Themen an. Dabei gibt's für Kinder und Familien so einiges zu erleben, zum Beispiel den "Waldwichteltag in der Glocke" oder die "Sagenwanderung in Ginzling". Die Kräutervielfalt kennenlernen können Interessierte im "Kräutergachtl in Hippach", bei der "Kräuterwanderung im Scheulingwald" oder beim "Wildkräuterspaziergang in Tux".
 Einfache Wanderungen wie "Vom Ziller bis zum Talbachwasserfall" werden ebenso angeboten wie mittelschwere Wanderungen, unter anderem zum "Naturdenkmal Schraubenfälle" oder zum "Sonnenaufgang über dem Tuxertal". Darüber hinaus kommt natürlich der geübte Wanderer und Tourengeher auf seine Kosten, ob bei der "Panoramatour im Zillergrund", "Auf dem Höhenweg nach Südtirol", auf "Die Ahornspitze mit Peter Habeler" uvm.
Einfache Wanderungen wie "Vom Ziller bis zum Talbachwasserfall" werden ebenso angeboten wie mittelschwere Wanderungen, unter anderem zum "Naturdenkmal Schraubenfälle" oder zum "Sonnenaufgang über dem Tuxertal". Darüber hinaus kommt natürlich der geübte Wanderer und Tourengeher auf seine Kosten, ob bei der "Panoramatour im Zillergrund", "Auf dem Höhenweg nach Südtirol", auf "Die Ahornspitze mit Peter Habeler" uvm.
Ein Highlight im August ist jährlich die Veranstaltung "Naturparkfest und Steinbockmarsch" mit Programm für Groß und Klein.
Ausführliches Veranstaltungsprogramm, Infos, Kontakte:
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen: Naturparkhaus Ginzling 05286/5218, info@naturpark-zillertal.at, TVB Mayrhofen-Hippach: 05285/6760, info@mayrhofen.at, TVB Tux-Finkenberg: 05287/8506, info@tux.at, Gemeindeamt Brandberg: 05285/63185, Zillertal Tourismus Schlitters: 05288/87187, info@zillertal.at
Anmeldungen: Im Veranstaltungskalender unter www.naturpark-zillertal.at sowie im Beherbergungsbetrieb bis 20.00 Uhr am Vortag. Beim Naturpark oder bei den TVBs bis 17.00 Uhr am Vortag.
„Bergsteigerbus“ in den Zillergrund: täglich 07.50 ab Bahnhof Mayrhofen
„Tuxer Wandertaxi“ bis 05.10. zur Jausenstation Stoankasern, Hobalm, Vallruckalm und Lämmerbichlalm. Treffpunkt: 09.15 Uhr beim Tux-Center Lanersbach (für Tuxer Gäste Abholung bei der Unterkunft), Anmeldungen (einen Tag vorher bis spätestens 21.00 Uhr): 0664/4260106
Quellen:
Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen
http://www.naturpark-zillertal.at/
Natur Eis Palast am Hintertuxer Gletscher
Kühle Naturschönheit tief im Erdinneren
Ein weltweit einzigartiges Naturjuwel befindet sich am Hintertuxer Gletscher – der "Natur Eis Palast". Rund 25 Meter unter der Skipiste liegt sie, die wunderbare eisige Welt – eine begehbare Gletscherspalte mit funkelnden Eiskristallen, magischen Eisstalaktiten, gefrorenen Wasserfällen und einem Gletschersee.
 Ein sicherer Weg führt vom Aussichtsplateau an der "Gefrorenen Wand" (3.250 m) bis vor die Tore des "Natur Eis Palasts". Hinein führt ein Pfad per Handlauf, erste Station ist die in mystisches Gletscherblau gehüllte und mit einem Farbenspiel aufwartende Eingangshalle. Funkelnde Eiskristalle in allen Formen und Größen beherbergt die Kristallkammer, die sich aufgrund der Temperaturunterschiede und Feuchtigkeitszufuhr ständig verändert. Eine weitere Besonderheit der Kristallkammer ist der Boden, ein gefrorener Gletschersee. Über diesen geht's zur blauen Kammer sowie zur Eiskapelle, die rot erleuchtet ist. Den Höhepunkt bildet der eigentliche "Eispalast", der mit einer Höhe von 15 Metern sowie lupenreinen Eisbildungen beeindruckt.
Ein sicherer Weg führt vom Aussichtsplateau an der "Gefrorenen Wand" (3.250 m) bis vor die Tore des "Natur Eis Palasts". Hinein führt ein Pfad per Handlauf, erste Station ist die in mystisches Gletscherblau gehüllte und mit einem Farbenspiel aufwartende Eingangshalle. Funkelnde Eiskristalle in allen Formen und Größen beherbergt die Kristallkammer, die sich aufgrund der Temperaturunterschiede und Feuchtigkeitszufuhr ständig verändert. Eine weitere Besonderheit der Kristallkammer ist der Boden, ein gefrorener Gletschersee. Über diesen geht's zur blauen Kammer sowie zur Eiskapelle, die rot erleuchtet ist. Den Höhepunkt bildet der eigentliche "Eispalast", der mit einer Höhe von 15 Metern sowie lupenreinen Eisbildungen beeindruckt.
Den Eispalast erkunden
 Im "Natur Eis Palast" herrscht eine konstante Temperatur von 0°C, warme Kleidung und festes Schuhwerk (auch Skischuhe sind möglich) sind also Voraussetzung für einen Besuch im Eis. Geöffnet ist ganzjährig, die Eishöhle bei jeder Witterung begehbar, Ausgangspunkt ist der "Natur Eis Palast"-Container an der Bergstation Gletscherbus 3, von dort sind es nur ein paar Minuten bis zum Eingang der Eishöhle. Den Besuchern stehen unterschiedliche Touren mit erfahrenen Guides zur Auswahl: Der Standard-Rundgang mit einer Dauer von 45 bis 60 Minuten, der die schönsten Attraktionen im Gletscherinneren zeigt; die ca. zweistündige wissenschaftliche Abenteuerführung, eine ausführliche Expedition durch den gesamten "Natur Eis Palast" mit Entdecker Roman Erler; eigene Kinderführungen. 30-minütige Schnuppertouren werden im Juli und August täglich um 15.15 Uhr angeboten.
Im "Natur Eis Palast" herrscht eine konstante Temperatur von 0°C, warme Kleidung und festes Schuhwerk (auch Skischuhe sind möglich) sind also Voraussetzung für einen Besuch im Eis. Geöffnet ist ganzjährig, die Eishöhle bei jeder Witterung begehbar, Ausgangspunkt ist der "Natur Eis Palast"-Container an der Bergstation Gletscherbus 3, von dort sind es nur ein paar Minuten bis zum Eingang der Eishöhle. Den Besuchern stehen unterschiedliche Touren mit erfahrenen Guides zur Auswahl: Der Standard-Rundgang mit einer Dauer von 45 bis 60 Minuten, der die schönsten Attraktionen im Gletscherinneren zeigt; die ca. zweistündige wissenschaftliche Abenteuerführung, eine ausführliche Expedition durch den gesamten "Natur Eis Palast" mit Entdecker Roman Erler; eigene Kinderführungen. 30-minütige Schnuppertouren werden im Juli und August täglich um 15.15 Uhr angeboten.
 Die VIP-Tour inkl. Bootsfahrt dauert rund eine Stunde und wird täglich um 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr durchgeführt. Auf der zweistündigen Fototour geht's zur Fotosession in die neuentdeckte Gletscher-Kathedrale. Beim "Stand Up Paddling" wird tief im Bauche des Gletschers der Eissee erkundet. Wer das ganz Außergewöhnliche erleben will, versucht sich beim Eisschwimmen im Gletschersee, der ebenso als offizielles Trainingsgebiet für die weltbesten Eisschwimmer dient.
Die VIP-Tour inkl. Bootsfahrt dauert rund eine Stunde und wird täglich um 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr durchgeführt. Auf der zweistündigen Fototour geht's zur Fotosession in die neuentdeckte Gletscher-Kathedrale. Beim "Stand Up Paddling" wird tief im Bauche des Gletschers der Eissee erkundet. Wer das ganz Außergewöhnliche erleben will, versucht sich beim Eisschwimmen im Gletschersee, der ebenso als offizielles Trainingsgebiet für die weltbesten Eisschwimmer dient.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Touren gibt's auf: www.natursport.at sowie unter Tel.: +43 (0)5287/87287 oder +43 676/(0)3070000, Voranmeldung für Kinderführungen und Sondertouren: info@natursport.at
Quellen:
Mehlerhaus Tux Madzeit
Wo die Zeit anschaulich erlebt werden kann
Es gibt sie noch, Plätze und Häuser, wo der Zeitgeist vieler Jahrhunderte wach ist. Im Mehlerhaus und im Jöchlhaus scheint's, als wäre die Zeit stehengeblieben. Dabei sind die beiden Heimatmuseen alles andere als "verstaubt", reichen ihre Aktivitäten doch bis ins Heute.
Ein ganz besonderes "Kulturerbe"
 Kultstätte und Zeugnis bäuerlicher Lebenskultur im Tuxertal ist das über 300 Jahre alte, urige "s' Mehlerhaus". Das "Kulturerbe" wurde 1999 von der Gemeinde Tux zu einem Kulturzentrum und Museum restauriert.
Kultstätte und Zeugnis bäuerlicher Lebenskultur im Tuxertal ist das über 300 Jahre alte, urige "s' Mehlerhaus". Das "Kulturerbe" wurde 1999 von der Gemeinde Tux zu einem Kulturzentrum und Museum restauriert.
Der Verein "Kulturerbe Mehlerhaus" mit Obfrau Alexandra Peer hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Mehlerhaus durch Belebung und Abwicklung kultureller Veranstaltungen zu fördern und erhalten. In der "Oberen Stube" im Untergeschoss werden in zahlreichen Bildern die Geschichte der Bewohnerinnen und Bewohner des Mehlerhauses sowie die Entwicklung der Gemeinde Tux dargestellt. Zusammengestellt und ausgearbeitet haben die Fotografien Schüler/-innen der NMS Tux. Im unteren Flur finden kleinere Ausstellungen statt, die mindestens einmal pro Saison gewechselt werden.
Leben anno dazumal
Der eigentliche Museumsteil befindet sich im oberen Geschoss. In der über den Balkon erreichbaren "Solderkammer" werden Arbeitsgeräte aus Haus und Hof präsentiert. Neben Werkzeugen und Fotografien zur Korbherstellung, Holz- und Flachsbearbeitungsgeräten, Küchenzubehör und Nähmaschinen, findet sich gleichfalls Material zur "Doggl"-Herstellung. In der "Hauserkammer" werden Gerätschaften aus dem bäuerlichen Arbeitsalltag, vorwiegend aus der Feld- und Waldwirtschaft, ausgestellt, außerdem historische Wintersport- und Transportgeräte wie Schlitten, Skier und Schneeschuhe. Allerlei Gegenstände des täglichen Lebens können in den Vitrinen am Gang begutachtet werden, zudem eine alte Schulbank sowie ein Paar in typischer Tracht. Die Schlafkammer, das "Obere Kammerl", zeigt eine original Schlafstätte von damals.
Lebensgrundlage Bergwerk
Der ehemalige Magnesitbergbau in Tux wird in der "Stubenkammer" dargestellt. Durch die Entdeckung von Magnesitvorkommen auf der "Stockwiese" und dem "Hoserkarl" zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Gemeinde Tux ihren ersten Wirtschaftsaufschwung erlebt. Auf 1.700 Meter Höhe ist 1920 ein Bergwerk mit Wohnsiedlung, Schule, Arzt, Barbarakapelle, Kino und Kegelbahn errichtet worden, in dem bis zu 400 Menschen aus dem gesamten Zillertal Arbeit gefunden haben. 1976 ist der Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt worden. Schautafeln, Mineralien, Bergwerkskleidung, Gezähe, Skizzen und Fotografien illustrieren diese Zeit.
3476 m am Tuxer Kamm
Seit dem Jahr 2017, in dem das Jubiläum "150 Jahre Erstbesteigung Olperer" gefeiert worden ist, beherbergt das Mehlerhaus ebenfalls die Ausstellung „Olperer 150“, die sich der alpinen Geschichte und dem Naturraum des Gletscherberges und "Tuxer Wahrzeichens" widmet, der im Jahr 1867 erstbestiegen worden ist. Geschichten rund ums Bergsteigen, Berufsbild eines Bergführers, sehen, hören und fühlen des alpinen Flairs sowie Bilder und Filme bringen den Olperer näher. Darüber hinaus gibt's Fotoshootings mit alten Ausrüstungsgegenständen, ein Kinderquiz und vieles mehr.
Hinein ins "s' Mehlerhaus"
 Von Juli bis September jeweils Montag und Freitag sowie im Winter jeden Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Bei rechtzeitiger Anmeldung können Gruppen das Mehlerhaus auch außerhalb der Öffnungszeiten besichtigen.
Von Juli bis September jeweils Montag und Freitag sowie im Winter jeden Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Bei rechtzeitiger Anmeldung können Gruppen das Mehlerhaus auch außerhalb der Öffnungszeiten besichtigen.
Kontakt: Alexandra Peer, 0676/6806503, dr.peer.tux@aon.at und Maria Tipotsch, 0650/9244516, maria-tipotsch@aon.at
Quellen:
Mehlerhaus Tux
Madseit
6294 - Tux
Der Freizeitpark Aufenfeld in Aschau im Zillertal
Sport, Spiel und Action
Ob sportlich aktiv, abenteuerliebend, entspannungssuchend oder spielerisch veranlagt – in der Ferien- und Feizeitanlage Camping Aufenfeld in Aschau finden Groß und Klein Abwechslung pur.
Ein Highlight im Freizeitpark ist der malerisch angelegte Badeteich mit Wasserfall, Holzstegen und großer Liegewiese. 
Des Weiteren sorgen Spielplätze, Hüpf- und Spielburgen, ein großer Kletterwürfel uvm. dafür, dass Langeweile erst gar nicht aufkommt.
Eine neu gestaltete Kletter- und Boulerhalle im Kletterzentrum Zillertal , eine überdachte Skaterbahn, Trampolinanlage, Bogenschießanlage, ein Funcourt, Tret-Gokartverleih sowie zwei Beachvolleyballplätze lassen Sportlerherzen höher schlagen.
In „Mount-Lake-City“ wird der „Wilde Westen“ wieder lebendig. Die Westernstadt wartet mit einer Sheriff-Station, einem Westernlehrpfad, einer Trapperstation, einem Indiander-Tipi sowie einem Reitgelände zum Ponyreiten im Zuge des Kinderprogramms auf. „Echte Kerle“ begeben sich zum Bullriding in den „White-Horse-Saloon“, und wen das „Goldfieber“ gepackt hat, der kann im Goldwaschcamp sein Glück versuchen und unter professioneller Anleitung allerlei edle Steine, darunter ein heiß begehrtes Gold-Nugget, finden. Juli und August findet im Westernfort Aufenfeld jeden Mittwoch ein Kinderfest statt.
Quellen:
Gezwitscher entlang des Vogellehrpfads in Hart
Eintauchen in die Zillertaler Vogelwelt
Südlich der Pfarrkirche in Oberhart beginnt der Weg hinein in die Welt der Bewohner der Lüfte. Der Vogellehrpfad führt zwei bis drei Stunden durch die Natur und zeigt auf, für welche Vögel das Zillertal Lebensraum bietet.

Schilder und Tafeln zu 44 heimischen Vögeln, zusammengestellt von Ornithologen, geben Interessantes und Informatives über die gefiederten Freunde preis. Der Rundweg, der auch für ältere Personen bequem zu begehen ist, führt teils auf Straßen, breiten Wegen und Wanderpfaden über Helfenstein und Niederhart wieder zurück nach Oberhart.

Entlang des Vogellehrpfads passieren Vogelliebhaber unter anderem den gleichermaßen pittoresken wie faszinierenden, 91 m herabstürzenden Schleierwasserfall und können in Volieren und der großen Freiflughalle die Tiere hautnah beobachten und erleben. Für Kinder, aber ebenfalls für Große, ein ganz besonderes Naturabenteuer.
Dem Teufel ein Schnippchen geschlagen
Der Teufel soll es gewesen sein, der die Brücke über die Klamm des Tuxer Bachs in Finkenberg 1876 gebaut und ihr den Namen gegeben hat.
 Der Sage nach wollten die Finkenberger Bauern mit einem Steg über den wilden Tuxer Bach Umwege sparen. Die Schlucht jedoch war tief und sie wussten deshalb nicht, wie sie dieses Problem lösen sollten. Da bot der Teufel seine Hilfe an und baute über Nacht die benötigte Brücke. Als Lohn forderte er jedoch die Seele des Lebewesens, das als erstes die Brücke überqueren würde. Da zeigten die Bauern wahre „Bauernschläue“. Sie trieben dem wartenden Teufel eine Ziege entgegen, auf welcher er schließlich mit lautem Gebrüll wieder gen Hölle fuhr.
Der Sage nach wollten die Finkenberger Bauern mit einem Steg über den wilden Tuxer Bach Umwege sparen. Die Schlucht jedoch war tief und sie wussten deshalb nicht, wie sie dieses Problem lösen sollten. Da bot der Teufel seine Hilfe an und baute über Nacht die benötigte Brücke. Als Lohn forderte er jedoch die Seele des Lebewesens, das als erstes die Brücke überqueren würde. Da zeigten die Bauern wahre „Bauernschläue“. Sie trieben dem wartenden Teufel eine Ziege entgegen, auf welcher er schließlich mit lautem Gebrüll wieder gen Hölle fuhr.
 Die gedeckter Holzbauweise – mit Vorgängersteg, Geländer und Dach - errichtete „Teufelsbrücke“, auch der „Teufelssteg“ genannt, steht heute unter Denkmalschutz und verbindet wie Finkenberger Weiler „Dornau“ im Süden und „Persal“ im Norden.
Die gedeckter Holzbauweise – mit Vorgängersteg, Geländer und Dach - errichtete „Teufelsbrücke“, auch der „Teufelssteg“ genannt, steht heute unter Denkmalschutz und verbindet wie Finkenberger Weiler „Dornau“ im Süden und „Persal“ im Norden.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Teufelsbr%C3%BCcke_(Finkenberg)
Branntwein- und Schnapsbrennereien Zillertal
Edle Tropfen / Edelbrände aus hochwertigen Früchten
Schnapsbrennen im Zillertal / Tirol / Österreich hat eine lange Tradition. Schon vor Jahrhunderten sind in zahlreichen Branntwein- und Schnapsbrennereien die edlen Brände hergestellt worden. Durch Gärung sowie anschließender Destillation verschiedener Obstsorten wird der Schnaps auch heute noch gewonnen.
Schnaps zählt im Zillertal zur Alltagskultur, wird er doch nicht nur zum Genuss getrunken, sondern gleichfalls als Heilmittel verwendet. So ist in alten Zeiten zur Herstellung von Medizin vor allem aus Wurzeln Schnaps gebrannt worden. Heute bieten viele Schnapsbrennereien im Zillertal ihre Edelbrände an.
Mit „Leib und Seele“ hat sich Edelbrandsommelier Armin Fankhauser der Erzeugung von Edelbränden und Likören verschrieben. Als Baumwärter versucht er in seiner „Genuss.Brennerei.Fankhauser“ in Tux-Vorderlanersbach Natur ins Glas zu bringen und „Edelbrände mit Persönlichkeit“ zu kreieren. Edle Tropfen gibt‘s hier zudem in der „Klares & Feines Schnapsbrennerei“ bei Andrea Fankhauser.
Die hauseigene Schnapsbrennerei, die „Stiefelscherm“-Schnapsbrennerei, im Apart Central Mayrhofen gibt interessierten Gästen Einblick in das Zillertaler Kunsthandwerk der Obst-Destillation – mit Früchten aus Bio-Obstbau -, auf Anfrage mit „Live-Schnapsbrennen“.
Schnapsbrennen ist die große Leidenschaft von Hannes Sporer von der Brennerei Klammsteinhof am Kleinschwendberg/Schwendau. Die Grundlage seiner Brände bilden ein Streuobstgarten sowie zwei kleine Obstplantagen. Ḿittlerweile kann er auf mehr als 80 prämierte Brände und Liköre bei nationalen und internationalen Prämierungen blicken, ist Sortensieger und mehrfacher Tiroler Landessieger.
In der urigen Schnapsbrennerei Innerummerland in Hippach können sich Besucher in die geheimen Prozesse einweihen lassen und verfolgen, in welchen Schritten frisches Obst zu bestem Obstbrand wird. Am Erbhof Ausserummerland am sogenannten „Schwendberger Sonnenhang-Platz“ in Hippach erzeugen Angelika und Brennmeister Markus Spitaler in ihrem charmanten „Brennhüttl“ seit 2005 hochwertige Edelbrände. Diese werden in der Schnapsbrennerei Spitaler nur aus vollreifen Früchten und besten Rohprokukten nach traditioneller Art im Kupferkessel doppelt gebrannt und bis zur harmonischen Reife gelagert.
Ebenfalls in Hippach, nämlich am Schwendberg, liegt die 2009 neu erbaute Schnapsbrennerei der Familie Kreidl. Dort wird in der kleinen, feinen Brennstube sehr auf Qualität und Sauberkeit geachtet, um hochwertige Brände und Liköre aus Obst und Wurzeln herzustellen.
Von Kunst, Handwerk und Tradition des Schnapsbrennens erzählt die Schaubrennerei Stiegenhaushof in Schwendau, deren Brennrechte noch von Kaiserin Maria Theresia stammen. Brennmeister Martin Fankhauser betreibt mit viel Begeisterung diese Kunst, die er von seinen Eltern und Vorfahren erlernt sowie übernommen hat. Anhand von Geschichten über die hohe Kunst des Schnapsbrennens, um Spannendes, Informatives und Wissenswertes führt er ebenso Besucher in die Geheimnisse der Schnapsherstellung ein.
Bereits um 1700 herum ist in der Gegend um Ramsau mit der Destialltion von Schnaps begonnen worden, sowohl alte Obstbäume als auch Häuser, Ahnentafeln und Werkzeuge zeugen noch davon. Die ältesten Gebäude der Region stammen aus dem Jahr 1640. Um diese Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ist 1998 eine der alten Almhütten abgetragen und auf dem Hof der Erlebnisbrennerei Feldishütte in Ramsau-Bichl originalgetreu wiederaufgebaut worden. Die Grundlagen für die Herstellung von Obstbränden ist gleich geblieben, Techniken und Werkzeuge haben sich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt. Diese Entwicklung kann in der Erlebnisbrennerei Feldishütte nachvollzogen werden.
Eine Speckselche sowie eine Schnapsbrennerei befinden sich im Alpengasthof „Enzianhof“ am Gerlosberg/Zell am Ziller. Neben Edelbränden gibt‘s hier Tiroler Schinken, nach Bauernart geräucherte Hauswurst sowie weitere Schmankerl aus eigener Landwirtschaft und Fleischerei. Selbstgebrannte Spezialitäten sind des Weiteren am Gerlosberg/Zell am Ziller in der Schnapsbrennerei am „Stockhof“ zu finden, wo Gäste mit einem „Begrüßungsschnapsl“ erwartet werden. In der Hochzeller Käsealm am Hainzenberg stellt Familie Rieser neben Käse und Speck ebenfalls feinsten Schnaps her.
Selbst hergestellt und doppelt gebrannt wird jede Sorte in der bäuerlichen Kleinbrennerei Kölblhof in Hart. Priska und Josef Kreidl empfehlen besonders ihren Zillertaler "Zichner", einen Zirbenschnaps.
Schnaps Verkostung
In fast allen Brennereien finden regelmäßig oder mit Voranmeldung Schnapsverkostungen statt. Dies ist eine gute Empfehlung bevor man sich für eine Flasche entscheidet.
Schnaps kaufen
Bei den verschiedenen Brennereien im gesamten Zillertal kann man auch direkt (und somit günstiger als im Geschäft) hochwertige Schnäpse
und viele weitere spezielle Zillertaler Edelbrände kaufen.
Geschichte Schnaps
Die Kunst des Schnapsbrennes hat im Zillertal eine lange Tradition und viele Betriebe vermitteln die Brennkunst von Generation zu Generation.
Bis zu 4000 Brennerein in Tirol haben Brennrecht seit Maria Theresias Zeiten.
Beliebte Schnapssorten im Zillertal und in Tirol
- Zirbenschnaps (der Zirbenbrand wird im Zillertaler Dialekt auch "Zichna" genannt)
- Meisterwurz Schnaps
- Obstler
- Zwetschgenschnaps
- Birnenschnaps
- Vogelbeerenschnaps
- Marillenschnaps
Quellen:
Fotos
istock
CherriesJD
Mianchikov
Ungerank
https://www.zillertal.at/
https://www.tiscover.com/at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Spirituose
Tirol.at
Der SchauBauernhof in Mayrhofen
Den Ursprung wertvoller Heumilch erleben
Der SchauBauernhof der ErlebnisSennerei Zillertal in Mayrhofen steht stellvertretend für rund 400 Bergbauernhöfe und Almen. Auf ihm lassen sich die ersten und zugleich wichtigsten Schritte in Sachen Entstehung wertvoller Lebensmittel erleben, nämlich die Tiere, die Spender der hochwertigen Rohstoffe, in ihrem artgerechten Umfeld.

Was macht die Heumilch von Kühen, Schafen und Ziegen so besonders, und warum sind Bienen so viel mehr als „nur“ Honiglieferanten? Dies alles können Besucher am SchauBauernhof erfahren und noch vieles andere. Fleißige Bienen, glückliche Hühner, entzückende Zicklein – am SchauBauernhof herrscht keine Langeweile, weder für die Kleinen noch für die Großen. Denn während sich der Nachwuchs beim lustigen Heuhüpfen, auf dem Minitraktoren-Parcours und der vermutlich „größten Heumilchkanne der Welt“, der Riesenrutsche mit Aussichtsturm, so richtig austoben kann, dürfen die Erwachsenen in der Leseecke oder gemütlichen Verweilzonen die Seele baumeln lassen.

Mit dem SchauBauernhof soll laut ErlebnisSennerei-Seniorchef Heinz Kröll ein Bewusstsein für die Herkunft von Lebensmitteln geschaffen werden, gemäß dem Leitsatz: „Denn nur, wenn es dem Tier gut geht, es in Ruhe wachsen und leben kann, erhalten wir zum Schluss ein Qualitätsprodukt, das einem nachhaltigen Kreislauf entspringt.“

Quelle:
https://www.erlebnissennerei-zillertal.at/unsere-erlebniswelt/schaubauernhof/
Das Murmelland an der Zillertaler Höhenstraße
Spiel, Spaß, Abenteuer und Natur >Das Murmelland Zillertal liegt direkt an der Zillertaler Höhenstraße und bietet in einer Höhe von 1.880 Metern ein einzigartiges Naturerlebnis für Groß und Klein.
 Rund um ihre Kaltenbacher Skihütte hat Familie Schweiberer einen Murmeltier-Park inklusive einem Erlebnisspielplatz geschaffen. Hier lässt sich im Murmeltier-Bau inmitten des Natur-Geheges eine Murmeltier-Familie entdecken, hier lassen sich Murmeltiere hautnah erleben, während echte Mini-Tiere im Streichelzoo darauf warten, gestreichelt sowie gefüttert zu werden. Wer alles „im Auge haben“ will, hat am „Hochsitz“, dem Aussichtsturm, den besten Überblick; die Murmel-Wasserspiele mit Wasserrad, Staustufen und vielem mehr – sogar das Wasser am Bach darf umgeleitet werden - sorgen wiederum „erdig“ für ein erfrischendes Abenteuer. In der Kinder-Murmelhöhle kann so einiges erforscht werden, mit der Murmel-Kinderseilbahn werden „Schwebeträume“ wahr und auf der Murmelrutsche geht‘s zwölf Meter vergnügt per Hosenboden abwärts. Noch mehr Spaß gibt‘s beim lustigen Fotoshooting: Einfach das Gesicht in ein lebensgroßes Murmeltier stecken und sich so fotografieren lassen.
Rund um ihre Kaltenbacher Skihütte hat Familie Schweiberer einen Murmeltier-Park inklusive einem Erlebnisspielplatz geschaffen. Hier lässt sich im Murmeltier-Bau inmitten des Natur-Geheges eine Murmeltier-Familie entdecken, hier lassen sich Murmeltiere hautnah erleben, während echte Mini-Tiere im Streichelzoo darauf warten, gestreichelt sowie gefüttert zu werden. Wer alles „im Auge haben“ will, hat am „Hochsitz“, dem Aussichtsturm, den besten Überblick; die Murmel-Wasserspiele mit Wasserrad, Staustufen und vielem mehr – sogar das Wasser am Bach darf umgeleitet werden - sorgen wiederum „erdig“ für ein erfrischendes Abenteuer. In der Kinder-Murmelhöhle kann so einiges erforscht werden, mit der Murmel-Kinderseilbahn werden „Schwebeträume“ wahr und auf der Murmelrutsche geht‘s zwölf Meter vergnügt per Hosenboden abwärts. Noch mehr Spaß gibt‘s beim lustigen Fotoshooting: Einfach das Gesicht in ein lebensgroßes Murmeltier stecken und sich so fotografieren lassen.
Rast und Ruhe bei bodenständiger Zillertaler Kost und Wildspezialitäten aus den „Gattern“ der Penison Schönblick finden Besucher in der „Kaltenbacher Skihütte“. Dort sind gleichfalls Murmelland-Tassen, ein jodelndes, pfeifendes Stofftier, der „Murmel-Michl“, sowie allerlei sonstige Produkte erhältlich.
Außerdem führen vom traditionellen Berggasthaus aus unterschiedliche Wanderwege auf die umliegenden Gipfel, z. B. auf den Kaltenbacher Hausberg, den „Gedrechter“ auf 2.217 m Höhe.
Das Murmelland Zillertal hat während der Sommersaison täglich von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.
Mehr Infos & Quelle:
https://www.murmelland-zillertal.at/
Das Kletterzentrum in Aschau
Ein Eldorado für Kletterfreunde
Ein wahres Paradies für alle Kletterfreaks befindet sich in Aschau. Im Kletterzentrum Zillertal kann auf einer über 1.300 m² großen Kletter- und Boulderfläche dem Bewegungsdrang freien Lauf gelassen werden.

2011 beim "Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld" von Familie Fiegl erbaut, wurde das private, öffentlich zugängliche Kletterzentrum Zillertal 2017/18 erweitert. Das Kletterzentrum ist ganzjährig geöffnet, jeweils Montag und Dienstag von 12 bis 22 Uhr, Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr. Bonus: Für Benutzer der Kletterhalle ist der Eintritt in den Freitzeitpark Aufenfeld mit Badesee inklusive. Zusätzliche Highlights sind unter anderem gratis Parkplätze, ein Kinderbereich und eine gemütliche Bar.

Die Indoor Kletterhalle
Die Kletterhalle, in der Montag bis Feitag von 12 bis 22 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 22 Uhr ohne Termin geklettert werden darf, hat für jeden etwas zu bieten. Eine rund 1.000 m² Vorstiegsfläche und eine ca. 330 m² große Boulderfläche laden Groß und Klein zum Klettern ein. Die Wandhöhe Indoor beträgt 16 Meter, die Routenzahl ca. 150, die maximale Routenlänge rd. 21 m. Die Boulderfläche sowie fünf Selbstsicherungsanlagen tragen dazu bei, dass auch ohne Partner, Klettertrainer oder Erfahrung geklettert werden kann.
Bouldern/Seilklettern/Selbstsicherung
Bouldern, das bedeutet Klettern in Absprunghöhe, in der Kletterhalle Zillertal in vier bis viereinhalb Meter Höhe, ohne Seil, über Fallschutzmatten. Über 60 verschiedene Boulderrouten warten auf die motivierten Kletteranfänger. Outdoor-Kletterern steht ein 50 m² großer Boulderblock zur Verfügung.
Einen Kletterschein vorweisen oder das Sichern fehlerlos beherrschen muss, wer Seilklettern möchte. Dafür stehen auf einer über 1.000 m² Kletterfläche Wandhöhen bis zu 16 m bereit. Die ca. 150 Kletterrouten sind in verschiedenen Schwierigkeitsgraden geschraubt. Zudem gibt es einen eigenen Toprobe-Bereich mit fix eingehängten Seilen. Bei Bedarf kann in dieser Halle die Kletterausrüstung ausgeliehen werden.

Das Sichern an den fünf automatischen Selbstsicherungsanlagen (zweimal 16 m, dreimal acht Meter) ebenso durch einen erfahrenen Kletterpartner möglich. Selbstständiges Klettern und Sichern kann außerdem in Kletterkursen im Gruppen- oder Privatunterricht erlernt werden. Nach kurzer Einschulung durch das hauseigene Team dürfen die Anlagen gleichfalls von Anfängern und Kindern ab 15 kg benutzt werden
Weitere Infos :
Abenteuer pur im Hochseilgarten
55 Stationen und 15 neue Zip-Lines (Flying Fox Parcours) bietet der neu ausgebaute Hochseilgarten in Gerlos. Der Hochseilgarten stellt eine Serie von Elementen dar, montiert auf einer Baumstammgruppe in zehn bis 15 Meter Höhe. So gleicht der Seilgarten einem Hindernisgarten aus Baumstämmen, Drahtseilen und Tauen, der in Form eines Parcours innerhalb zweier Stunden absolviert wird.

Einer kleinen Einschulung bedarf's, dann können Mutige ihr Abenteuer starten und ihr Geschick strapazieren. Für die Jüngsten ist ein eigener Parcours mit zehn kindgerechten Stationen errichtet worden, dieser stellt unterschiedliche Aufgaben an die Kids. Kinder ab einer Größe von 105 cm erfahren hier an der Seite ihrer Eltern (ab 140 cm ohne Begleitung möglich) spielerisch in einer Höhe von zwei bis drei Metern den Gleichgewichtssinn zu fördern und dabei noch jede Menge Spaß zu haben. 
Für spezielle Sicherheit des Nachwuchses ist mit dem "Smart Belay" gesorgt: Ein offener Karabiner wird von einem zweiten Karabiner erkannt und der Öffnungsmechanismus bei produktgerechter Anwendung so lange blockiert, bis der erste Karabiner wieder am Sicherheitsseil eingehängt und verriegelt ist. Ein versehentliches Komplettaushängen ist somit – ein ordnungsgemäßer Gebrauch vorausgesetzt - praktisch nicht möglich.
Als Ausrüstung haben sich Sportbekleidung sowie Turn- oder Trekkingschuhe bewährt. Geöffnet ist der Hochseilgarten im Juli und August täglich von 10 bis 17. Uhr, es ist keine Voranmeldung nötig. Im Mai, Juni und September ist das Betreten des Hochseilgartens nur nach Voranmeldung möglich: Berg aktiv, 0043 (0)5284/5630
Quelle:
Fotos (c) Zillertal Arena
Mehr Infos unter:
Hinein ins Abenteuer vergangener Zeit
Das Innere des Berges lebendig werden und einen beinahe vergessenen Wirtschaftszweig wiederaufleben lässt eine eindrucksvolle Multimediapräsentation im Goldschaubergwerk in Zell am Ziller.
 350 Jahre Kultur können Besucher im Goldschaubergwerk Revue passieren lassen und dabei einen Eindruck von den harten Arbeitsbedingungen unter Tage, dem Lebensstil der Bergleute und deren sozialem Umfeld gewinnen. Dabei werden ebenso die politischen Konflikete zwischen Tirol und Salzburg, die wirtschaftlichen Hintergründe sowie der starke Einfluss der Kirche nicht außer acht gelassen.
350 Jahre Kultur können Besucher im Goldschaubergwerk Revue passieren lassen und dabei einen Eindruck von den harten Arbeitsbedingungen unter Tage, dem Lebensstil der Bergleute und deren sozialem Umfeld gewinnen. Dabei werden ebenso die politischen Konflikete zwischen Tirol und Salzburg, die wirtschaftlichen Hintergründe sowie der starke Einfluss der Kirche nicht außer acht gelassen.
Begonnen wird die Exkursion ins Goldbergwerk bei der Hochzeller Käsealm von Familie Rieser am Hainzenberg, die drei Kilometer oberhalb von Zell Richtung Gerlos liegt. Mit Besichtigung der historisch wichtigen Stätten und der Stollenanlage dauert diese rund zwei Stunden. Die Rückfahrt erfolgt originell mit dem „Zillertaler Goldexpress“, abgerundet wird die Exkursion mit einer Führung durch die Käserei und Verkostung der Käsespezialitäten.
 Weitere Highlights sind ein weitläufiges Tiergehege mit heimischem Berg- und Niederwild sowie vielen anderen Kleintieren; ein Goldwaschcamp, wo in einem Sichertrog, der sogenannten „Goldpfanne“, Gold gewonnen werden kann, sowie eine über 150 Jahre alte originalgetreu wiederaufgebaute Almhütte, die ein Museum mit alten Gerätschaften beherbergt.
Weitere Highlights sind ein weitläufiges Tiergehege mit heimischem Berg- und Niederwild sowie vielen anderen Kleintieren; ein Goldwaschcamp, wo in einem Sichertrog, der sogenannten „Goldpfanne“, Gold gewonnen werden kann, sowie eine über 150 Jahre alte originalgetreu wiederaufgebaute Almhütte, die ein Museum mit alten Gerätschaften beherbergt.
Quelle:
Der Arena Skyliner am Gerlosstein
Adrenalin-Kick für Abenteuerlustige
Er ist nichts für schwache Nerven – der "Almflieger Gerlosstein". Das Fluggerät, eine Weiterentwicklung des "Flying Fox", bietet noch mehr Action, Spaß sowie eine atemberaubende Sicht aus der Vogelperspektive. Über vier Strecken mit einer Länge bis zu 738 m führt der "Almflieger" über das Gerlossteiner Gebiet – und das mit einer Fahrgeschwindigkeit bis 50 km/h.
Je nach Wetterlage ist der "Almflieger Gerlosstein" von ca. Ende Mai bis nach den 20. September in Betrieb. Täglich stehen vier rund eineinhalbstündige Touren auf dem Programm, geführt von zwei qualifizierten "Arena Guides". Treffpunkt ist jeweils bei der Bergstation der Gerlossteinseilbahn, mit der dann die Auffahrt erfolgt.
Kindern bis zu zehn Jahren ist die Benützung des "Almfliegers" nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt, Zehn- bis 14-Jährige benötigen eine mindestens 16-jährige Begleitperson. Eine Voraussetzung für die Nützung des Almfliegers ist Schwindelfreiheit, ebenso sind festes Schuhwerk und Sportbekleidung erforderlich. Die weitere Ausrüstung wird gestellt.
Anmeldung (um telefonische Voranmeldung wird gebeten) und Informationen: Gerlossteinseilbahn/"Arena Guide":
0043 (0) 664/44 19 283
Quelle:
Fotos (c) Zillertal Arena
Mehr Infos unter:
Zillertaler Höhenstraße – ein Fahrerlebnis für die Seele:
Die Zillertaler Höhenstrasse ist im Moment geschlossen & öffnet vermutlich Ende April 2020 wieder!
Umgeben von prachtvollem Panorama, schlängelt sie sich auf einer Länge von 50 Kilometern und einer Höhe von bis zu 2020 Metern und zählt zu den schönsten Hochalpenstraßen in Österreich – die Zillertaler Höhenstraße.

Die Bergstraße liegt in den Tuxer Voralpen, im südlichen Bereich des Zillertals, und besteht aus einer Scheitelstrecke sowie fünf Zufahrtswegen. Die ungefähr 20 Kilometer lange Hauptstrecke verläuft an der westlichen Hangseite des Taltroges, meist oberhalb der Baumgrenze. Da die Strecke vorwiegend einspurig ist, waren Ausweichstreifen unumgänglich, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten. Auf der Denzel-Alpenstraßen-Skala liegt der Schwierigkeitsgrad in diesem Abschnitt zwischen 2 und 3.
Der gesamte Streckenabschnitt wurde als idyllisch anmutende Panoramastraße angelegt.


Die Zufahrtswege führen von den Talgemeinden Ried i. Z., Kaltenbach, Aschau i. Z., Zellberg und Hippach zur Zillertaler Höhenstraße und sind durchschnittlich acht Kilometer lang. Die nördlichste Zufahrtsstraße zur Hauptstrecke startet auf einer Höhe von 573 Metern in Ried. Sie führt zur Mautstelle Nord, die auf 1400 Metern in der Nähe des Riedbachs liegt und das nördliche Ende der Scheitelstrecke bildet.
Zur Mautstelle Nord führt ebenfalls die Zufahrtsstraße von Kaltenbach aus. Der Ort liegt auf 558 Metern.
Eine Auffahrtsstraße von Hippach aus, führt von 604 Metern hinauf aufs südliche Scheitelstrecken-Ende in einer Höhe von 1730 Metern. Auf den Zufahrtswegen von Zellberg und Aschau kann gleichfalls die Zentralstrecke angefahren werden, jedoch keiner der Endpunkte. Die Zillertaler Höhenstraße kann mit PKW und Reisebus bis zu einer Länge von 10,5 Metern befahren werden.
Sportliche erklimmen die Hochalpenstraße sogar mit dem Mountainbike. Ein Linienbus fährt Ramsau/Bahnhof bis Melchboden, wein zweiter von Aschau über Stumm, Kaltenbach, Ried bis zum Almgasthof Zirmstadl.

Ursprung einer Top-Alpenstraße
Erbaut wurde die Zillertaler Höhenstraße Anfang der 60er-Jahre, allein zu nützlichem Zwecke. Durch eine Schotterstraße sollten Almen besser bewirtschaftet werden können sowie durch Wildbachverbauung Überschwemmungen vorgebeugt werden. Zudem galt es, bergtechnische Sicherheitsvorrichtungen zu errichten, um vor Murenabgängen und Lawinen geschützt zu sein. Doch der einzigartige Ausblick von der Straße aus auf die Zillertaler Bergwelt blieb nicht unbemerkt und so war es nur eine Frage der Zeit, bis die einfache Straße auch für Gäste geöffnet wurde. Dies geschah noch Ende der 60er-Jahre und zwar durch die Weggemeinschaft Zillertaler Höhenstraße, der die fünf Mitgliedsgemeinden angehören.
Derzeitiger Obmann ist Erich Klocker.
1978 wurde als letzte die Anbindung von Zell über Zellberg hinauf gebaut. Da durchgehende Asphaltierung sowie Instandhaltung der Scheitel- und Zufahrtsstrecken natürlich Geld kosten, wurde nun eine Mauteinhebung notwendig. Diese gilt für die Scheitelstrecke, die Zufahrtsstraßen sind mautfrei.
Panoramablick von der Zillertaler Höhenstraße
Musikalisch die Höhenstraße entlang
Zur Belebung der Zillertaler Höhenstraße trugen ebenfalls typische Zillertaler Volksklänge bei. Schon 1973 eröffneten Herta und Friedl Fankhauser auf der Hirschbichlaste eine Jausenstation.
Just im selben Jahr, als das Zellberg-Duo zu musizieren begann und somit auch die Musik auf der Zillertaler Höhenstraße einzog. Mittlerweile ist der Alpengasthof Hirschbichlalm ein Treffpunkt für alle Musikfreunde, vor allem Fans der "Zillertaler Haderlumpen", ist doch Reinhard Fankhauser, der mit Gattin Bianca das Lokal betreibt, ein "waschechter Lump".
Jeden Sonntag gibt's auf der Hirschbichlalm Live-Musik mit bekannten Zillertaler Musikgruppen.
Musikalisch hoch her geht's ebenso im Almgasthaus Zellberg Stüberl, dem Heimathaus der Zellberg Buam. Gerhard Spitaler, Chef der Zellberg Buam, und sein Sohn Georg, der bei den "Fetzig'n aus dem Zillertal" aufspielt, betreiben das Stüberl gemeinsam und begeistern die Gäste mit Hausmusik zur Mittagszeit. Zudem sorgen verschiedene Almfeste für Kurzweil, während die nahe Hauskapelle zum Entschleunigen einlädt.
Von urig bis cool – Lokalitäten an der Höhenstraße
Viele weitere Hütten und Gasthäuser laden an der Zillertaler Höhenstraße und deren Umgebung zum Verweilen ein. Hautnahen Kontakt mit der Tier- und Pflanzenwelt sowie g'schmackige Almspezialitäten gibt's auf der Jausenstation Grünalm von Gerti und Peter Hundsbichler.
Rund um die Kaltenbacher Skihütte bei Alexandra und Stefan Schweiberer enthüllt das Murmelland Zillertal Naturerlebnisse pur – mit Spiel- und Erlebniseinrichtungen sowie zahlreichen Tieren. Lifestyle und Kunst am Berg sowie einen Hauch von Luxus wiederum gibt's im "Juwel der Alpen", der Kristallhütte bei Familie Eder. Wer bei Familie Lechner in der Jausenstation Melchboden, am höchsten Punkt der Höhenstraße, einkehrt, kann nach der Rast regelrecht "in die Luft gehen", befindet sich doch dort der offizielle Startplatz für Para- und Hängegleiter.

"Dem Himmel ein Stück näher" kommen Gäste im Berggasthof Platzlalm bei Eva und Martin Wimpissinger. Ein neuer Kinderspielplatz macht das Almgasthaus Zirmstadl von Familie Wegscheider besonders für Familien zum beliebten Ausflugsziel. Auch hochalpin kann ein guter Tropfen genossen werden, vor allem in der Wedelhütte bei Manfred Kleiner im höchstgelegenen Weingewölbe.

Kathleen Dammann betreibt die DAV-Schutzhütte Rastkogelhütte, eine Alpenvereinshütte des Deutschen Alpenvereins.
einspurige Fahrzeuge € 5.-
PKW bis 6 Personen und
mehrspurige KFZ € 8.-
PKW und Kleinbusse € 17.-
Omnibusse mit mehr als 12 Plätzen € 22.- (Die Zillertaler Höhenstraße ist mit Reisebussen bis zu einer Länge von 10,5 m befahrbar!)
Monatskarte € 25.-
Saisonkarte € 80.-
Quellen:
http://www.zillertaler-hoehenstrasse.com/
https://de.wikipedia.org/
Fichtenschloss in Zell am Ziller

Lassen Sie sich verzaubern - auf der Rosenalm bei Zell am Ziller. Auf der Rosenalm hoch über Zell am Ziller gibt es einen Ort der Fantasie - das Fichtenschloss!
(Auffahrt mit der Rosenalmbahn)

Jede Kindheit steckt voller Zauber und magischer Momente - im Fichtenschloss mit den Fichtenwichteln können Sie und Ihre Familie diese Lebensfreude wieder entdecken. Vor langer, langer Zeit kamen die fleißigen Fichtenwichtel auf die Rosenalm und haben für das Prinzenpaar, das zukünftig dort oben leben soll, mit viel Liebe eine weitläufige Schlossanlage gebaut.
Große und kleine Gäste der Zillertal Arena können sich nun beim Kraxeln auf dem Kletterturm, beim Rutschen im Rutschenturm oder beim Werkeln im Kranturm, austoben. Den grandiosen Blick auf die umliegende Bergwelt genießt man am besten von dem 18m hohen Aussichtsturm aus. Neben einem großzügigen Wasserspielbereich und einem Erlebnisspielplatz, finden kleine Baumeister in der Fichtenwichtelbauhütte und im Kranturm auch zahlreiche Möglichkeiten, das Werk der Fichtenwichtel fortzuführen. Gemütliche Plätze zum Rasten und die Seele baumeln zu lassen, fehlen ebenfalls nicht - so macht Sommerurlaub im Zillertal noch mehr Spaß!

Fichtenschloss Fakten:
Über 5.000 m² "Schloss-Areal"
4 begehbare Türme (Rutschenturm, Kranturm, Kletterturm, Aussichtsturm)
Erlebnis-Spielplatz
Wasserspiel- und Sandspielbereich
Baumwipfelweg
Fichtenwichtel-Bauhütte
Genuss und Relaxplätze für Groß und Klein Schlossküche mit Grillplatz
TIPP: Von 11 bis ca. 14 Uhr können Sie Ihr mitgebrachtes Grillgut auf unserem Wichtel-Grill braten. Auch am Schloss-Grill-Automaten im Fichtenschloss gibt es Würstchen vom lokalen Metzger zu kaufen!
Quelle: Zillertal Arena
Diese & noch mehr Informationen auf:
https://www.zillertalarena.com